FUSSBALLSTADIEN
Stadion St. Jakob (Joggeli) 25.4.1954 bis 12.12.1998 Gesamtkapazität 60'000 (Tribüne 8'184 Plätze) - Spielfeld 105 x 68,5 m
Das 1937 in Angriff genommene, ganz auf baselstädtischem Boden liegende Kampfstadion auf dem Geländeviereck zwischen der Gellertstrasse, der St. Jakobs-Strasse, der Birsstrasse und dem Bahndamm der SBB wurde nach Abbruch der Arbeiten während des Krieges für die Weltmeisterschaft 1954 fertiggestellt und war primär für internationale Spiele konzipiert. Während geraumer Zeit gab es dort mit dem in die Höhe ragenden und im späteren Endausbau den Westeingang markierenden Marathontor versehen ein von aufgeschütteten, noch nicht ausgebauten Zuschauerrampen umgebenes, planiertes Feld, auf dem beim Bau des Kleinhüninger Hafenbeckens II geschürfter Kies deponiert worden war. Dieses Stadion am Bahndamm diente anfänglich vor allem der Jugend der umliegenden Quartiere als Treffpunkt, bis es ab September 1948 soweit hergerichtet war, dass in den unteren Ligen auch offizielle Spiele ausgetragen werden konnten.
Das Stimmvolk lehnte am 23.11.1952 einen Kredit in der Höhe von 3,5 Millionen Franken für seine Weiterführung an der Urne knapp ab. Auf eigene Rechnung musste nun ein stark reduziertes Projekt erstellt werden, wofür als treibende Kraft der damalige Präsident der Sport Toto-Gesellschaft, Ernst B. Thommen, mit Freunden die Genossenschaft Fussballstadion St.Jakob gründete. Im Frühjahr 1953 fuhren die Baumaschinen wieder auf. 1954 stand das 'Joggeli' als Austragungsort der WM-Spiele in Basel bereit.
Der FC Concordia, der Anteilsscheine zeichnete, sicherte sich das Recht eines ersten Platzclubs. Er konnte für lange Jahre einen nicht unwesentlichen Teil seiner Einnahmen aus dem Unterhalt des Wirtschaftsbetriebes finanzieren. Präsident der Stadiongenossenschft war als ein Mitglied des Vereins von den sechziger Jahren an bis zum Baustart des St. Jakob-Parks 1998 der langjährige Basler Volkswirtschaftsdirektor Edmund Wyss.
Offizielle Einweihung der Beleuchtungsanlage am 11. September 1957 im Rahmen der Festlichkeiten '2000 Jahre Basel' mit dem Spiel Basler Stadtelf - AS Roma („erstmals erstrahlten in voller Stärke die Flutlichter und versetzten das Stadion in eine wundersam meergrüne Märchenstätte“ - Tip 17.9.1957): Meisterschaftsspiele bei künstlicher Beleuchtung waren in der Nationalliga ab Oktober 1954 gestattet, wobei sich der Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung zuerst nur auf verschobene Partien bezog. „Auf der Südrampe wurden zwei hohe Scheinwerfermasten errichtet, von denen 30 Tiefstrahler ihr Flutlicht auf das Stadion werfen. Ebensoviele Scheinwerfer sind am Tribünendach montiert, so dass der gepflegte Rasen bei Nacht als hellgrüner Teppich zum Fussballspielen direkt einlädt. Auf der Südseite sind nun auch die Stehrampen voll ausgebaut“ (Basellandschaftliche Zeitung). Die Spielfeldbeleuchtung wurde 1965 auf 300 Lux („nun geht das Meisterschaftsspiel des FC Basel gegen die Grasshoppers unter viel besseren Lichtverhältnissen in Szene. Alle Lampen sind ausgewechselt worden und an Stelle des etwas dumpfen gelben Lichtes flutet nun viel stärkeres weisses Licht über das Spielfeld“ - NZ 20.9.1965), 1969 (Installation zusätzlicher 2000-Watt-Lampen) sowie 1973 an vier neuerstellten Masten mit Abnahme am 26. April für Farbfernsehaufnahmen (900 Lux) verstärkt.
Ausbau der Stehrampen am oberen Teil des Bahndamms mit 23 Betonstufen für rund 10'000 Besucher 1957. 1961 zwischen dem Ostflügel der Tribüne und der Garage Bau einer Wohnung für den vollamtlich engagierten Platzwart und Erstellen von vier separaten Kassenhäuschen, nachdem sich bei Grossveranstaltungen die mobilen Kassenhäuschen der MUBA und des Reiter-Clubs nicht bewährt hatten. 1965 wurden die Zuschauerrampen fertigbetoniert und die Ehrenlogen ausgestaltet. Die Stehrampen und der östliche Zugang wurden 1969 saniert. Am 3.12.1977 konnte im Ostflügel der Tribüne eine Donatoren-Lounge eröffnet werden.
Im Rekordjahr 1970 zählte die Stadiongenossenschaft 452'603 zahlende Zuschauer.
„Das gab es in Basel seit Bestehen des Joggeli noch nie - ein Länderspiel, bei dem die Securitas die obere Rampe am Bahndamm absperren musste. Die Absperrung der Fans vor dieser so traditionsreichen Zone, wer erinnert sich nicht der Rutschpartien und Steinwurfaktionen, als dort oben noch nicht alles ausbetoniert war“ (Schweiz - Polen 2:1, 6737 abgesetzte Tickets - BN 12.5.1976)
Aufgrund verschiedener Vorkommnisse musste der FC Basel das Stadion auf die Saison 1971/72 mit einem Gitter versehen lassen. Aus Sicherheitsgründen konnte es statt für 60'000 nur noch bis 55'000 Besucher ausgelastet werden.
Bereits 1979 mahnte der Präsident des FC Basel wegen der fehlenden Überdachung der Stehrampen, dem mangelnden Komfort der Sitzplätze und den veralteten sanitären Einrichtungen Verbesserungen an. Die geplante Überdachung scheiterte an den Schweizerischen Bundesbahnen, weil diese eine solche zuerst nur unter Verlust der oberen Stehplatzrampen zugestanden hatten und dann an der Finanzierung.
1996 wurde das Stadion in fünf Sektoren mit separaten Verpflegungsständen und Toilettenhäuschen unterteilt (Tribüne, Gästeblock zwischen Restaurant und Marathontor, Muttenzerkurve, untere Gegengerade und oberer Block beim Bahndamm), die jeweils eigene Eingänge erhielten. In der Muttenzerkurve wurden als Stahlrohr-Geländer sogenannte 'Wellenbrecher' installiert. Auch eine neue Beschallungsanlage wurde eingebaut.
Am 6. März 1996 wurde auf Anweisung des Polizei- und Militärdepartementes das von der Fifa und der Uefa verfügte Verbot von Signalfackeln für den FC Basel als ersten Schweizerischen Club beschlossen. Glasgefässe und Wurfgegenstände jeglicher Art waren von der Nationalliga bereits spätestens ab dem 1. Juli 1969 verboten worden:
„Mit einer Busse von 1000 Franken wird der FC Basel belegt, weil Zuschauer beim Meisterschaftsspiel Basel-Young Boys vom 17. Mai nach einem Abseitsentscheid des Schiedsrichters Flaschen aufs Spielfeld geworfen haben“ (1975 - bereits vier Jahre vorher war der Club wegen gleicher Vorfälle gebüsst worden)
„Zu einem einzigartigen, bis jetzt in der Geschichte der Nationalliga einmaligen Vorfall kam es bei diesem Treffen auf dem Stadion St. Jakob. Nach dem Ausgleichstor der Gastgeber, und nachdem der der linke Flügel der Einheimischen mit Wucht ins Tornetz gerannt war, brach zum allseitigen Erstaunen die Torlatte. Es war den Verantwortlichen in der nötigen Frist nicht möglich, die Reparatur vorzunehmen, so dass das Treffen nach 67 Minuten Spieldauer beim Stande von 1:1 vom Schiedsrichter abgebrochen werden musste“ (FC Basel - FC Luzern - Tip, Schweizer Sportmagazin 11.9.1962)
FC Basel
1893-1967 Stadion Landhof, bzw. vor 1902 zwischenzeitlich Ausweichplätze Schützenmatte und Thiersteinerallee
(„nach allerlei Wechseln ist es gelungen, den früher innegehabten Platz Landhof wieder zu seinen Übungen zu gewinnen“ - National-Zeitung)
FC Concordia (ab Saison 1954/55)
erstes Vereinsjahr Margarethenwiese als Untermieter des FC Old Boys. Das zweite Terrain befand sich bis zu seiner Überbauung südwestlich der Ecke Delsbergerallee/ Dornacherstrasse („ein 'Spielfeld', schräg abfallend, steil ansteigend, von einem Aepfelbaum, von einem massigen Grenzstein mit verschiedentlicher Auswirkung in teilweisen Besitz genommen“ - Präsident E. Uhl anlässlich der 20. Jahresfeier)
September 1909 bis 1917 Terrain äussere Gundeldingerstrasse auf dem Gebiet des Dreispitz bei den Pulvertürmen zwischen Gundeldinger- und Reinacherstrasse, das zu Pflanzlandzwecken des Schweizerischen Konsumvereins abgegeben werden musste. Ab 20. Mai 1917 an der Kantonsgrenze entlang des Leimgrubenweges zwischen den Geleisen unweit des alten Terrains. Ab der Spielzeit 1918/19 - genau ab dem 18. September, „ausserhalb St. Jakob auf der rechten Seite der Birs und der Birsfelder Seite des Bahndamms“ an der Bahnlinie Muttenz-Basel als Terrain in der Hagenau (hierhin siedelte 1919 auch der Landhockey-Club Basel um).
18. Dezember 1921 (Eröffnungsspiel FC Concordia - SV Helvetik Serie B) bis 1940 an der Peripherie der Stadt an der Strasse nach Reinach Sportplatz Heiligholz (Gemeinde Münchenstein) durch den Kauf eines 10'300 Quadratmeter umfassenden Grundstücks bei der Gartenstadt (28. Juni 1920): Concordiastrasse unmittelbar bei der Tramstation. Die erste Mannschaft musste ihre Spiele nach dem Aufstieg 1923 auf dem Landhof oder dem Rankhof austragen, weil das Heiligolz nur für Meisterschaftsspiele bis Serie B abgenommen war und abgesehen davon trotz Tramverbindung zu sehr ausserhalb der Stadt lag.
Nach 1940 auf dem (Stadion) St. Jakob, Rankhof oder Landhof und häufig als Doppelveranstaltung mit anderen Basler 1. Liga-Clubs. Später tauschte Concordia sein Gastrecht im Joggeli mit dem FC Basel und spielte in den 70er Jahren ausschliesslich auf dem Landhof und danach auf den Sportanlagen Bachgraben. Mit dem Neubau des Leichtathletikstadions ging Concordia 1984 auf die Sportanlagen St. Jakob zurück, aber musste seine Heimspiele nach dem Aufsieg in die Nationalliga B, bzw. Challenge League nach Ablauf einer kurzen Ausnahmebewilligung von 2001 bis 2009 im Rankhof austragen (untere Mannschaften Sportanlagen St. Jakob).
Höchste Zuschauerzahlen:
16.5.1984 Europapokalfinal der Pokalsieger - Juventus Turin vs. FC Porto 58'861 Zahlende (ausverkauft - aufgrund verschiedener baulicher Massnahmen konnte man erstmals mehr als 58'000 Billette drucken lassen)
17.6.1983 Freundschaftsländerspiel - Schweiz vs. Brasilien über 57'000 Zahlende (gemeldet 60'000, ausverkauft: eine Stunde vor Spielbeginn ergingen erste Aufrufe des Platzspeakers an die schon 40'000 Anwesenden, näher zusammenzurücken)
16.5.1979 Europapokalfinal der Pokalsieger - FC Barcelona vs. Fortuna Düsseldorf 4:3 n.V. über 57'500 Zahlende (offiziell 58500, ausverkauft)
Wenig verwöhnt worden war Basel als Austragungsort zweier Endspiele um den europäischen Pokal der Pokalsieger am 21.5.1969 zwischen Slovan Bratislava und dem FC Barcelona mit 19'478 sowie am 14.5.1975 zwischen Dynamo Kiew und Ferencváros Budapest mit nur 10'897 verkauften Eintrittskarten. 2016 geriet die Uefa in Erklärungsnot, als in der Europa League mit FC Liverpool gegen Sevilla FC im 2001 neu eröffneten St. Jakob-Park dagegen eine attraktive Finalpaarung feststand. Auf ihren Entscheid von September 2014, das Spiel in der nur 35'000 Besuchern Platz bietenden Arena stattfinden zu lassen, konnte sie nicht zurückkommen, weshalb das fünfte Basler Europacup-Endspiel tausende, vor allem britische Fans, ohne Ticket in den Public-Viewing-Zonen der Stadt verfolgen mussten.
30.6.1954 WM-Halbfinal - Deutschland vs. Österreich 57'991 Zahlende (ausverkauft)
20.6.1954 WM-Gruppenspiel - Deutschland vs. Ungarn 55'994 Zahlende
17.4.1968 Länderspiel - Schweiz vs. Deutschland 55'057 Zahlende (ausverkauft)
„Es mögen so an die 60'000 Zuschauer gewesen sein, die den beinahe sommerlich warmen Mittwochabend dazu benützten, auf erlaubten und verbotenen Plätzen das 38. Länderspiel zwischen der Schweiz und Deutschland mitzuerleben. Im ausverkauften Stadion St. Jakob herrschte eine Stimmung, wie man sie nur selten erlebt, obwohl das Basler Publikum momentan in Sachen Fussball ziemlich verwöhnt wird“ (Pu - Tip, Schweizer Sportmagazin 23.4.1968)
„Die offiziell mit 55'000 angegebene Zuschauerzahl (aus Sicherheitsgründen wurden nicht mehr als 55'000 Karten ausgegeben) ist wesentlich höher - die Schätzungen schwanken zwischen 60'000 und 63'000 (...) Mehrere Tausende, die sich erst spät für den Gang nach St. Jakob entschlossen und kein Billet mehr erhalten haben, hatten nämlich ein 'Hangbillet' genommen, sei es, dass sie in das Bahngelände oben an den Stehplatzrampen eindrangen, sei es, dass sie etwa eine Viertelstunde vor Spielbeginn an der Stelle, die wegen der Bauarbeiten provisorische Einfriedung an der Gellertstrasse eindrückten und sich unkontrolliert unter die zahlenden Zuschauer mischten (...) Es waren vor allem Deutsche, die spät und ohne Billette nach Basel gekommen sind“ (BN 18.4.1968)
10.6.1972 Meisterschaft NLA - FC Basel vs. FC Zürich 53'702 Zahlende
9.10.1955 Länderspiel - Schweiz vs. Frankreich 52'300 Zahlende (allein im Elsass wurden rund 15'000 Billette abgesetzt)
25.4.1954 Länderspiel - Schweiz vs. Deutschland 51'864 Zahlende (ausverkauft, zusätzliche Sitzplätze auf der Westrampe. Stadioneröffnung. In Deutschland wurden total 11'400 Karten verkauft)
9.5.1973 WM-Qualifikationsspiel - Schweiz vs. Türkei 50'868 Zahlende („und darüber hinaus schätzungsweise 5'000 Ehrengäste, Funktionäre, Presseleute und Schwarzseher, die durch die Tore strömten“)
12.4.1967 Schweizer Cup-Halbfinal - FC Basel vs. FC Lugano 50'341 Zahlende
13.10.1971 EM-Qualifikationsspiel - Schweiz vs. England 47'877 Zahlende (das Spiel wurde wohl aus Sicherheitsgründen mit 56'000 Zuschauern bereits vorher als ausverkauft gemeldet, die Tageskassen waren nicht mehr geöffnet: Mit Radio und Fernsehen 170 Journalisten und 60 Fotografen akkreditiert)
„Obwohl man seit einigen Jahren an grosse Zuschauerzahlen gewöhnt ist, stellte es zweifelsohne ein Novum dar, dass die Organisatoren bereits einige Tage vor dem festgesetzten Datum in Presse, Radio und Fernsehen bekannt geben mussten, dass keine Eintrittskarten mehr zu haben seien und dass man daher dringend davon abrate, ohne Billett nach Basel zu reisen“ (BN 14.10.1971)
5.6.1963 Länderspiel - Schweiz vs. England 47'588 Zahlende (vorgängig hatte vor bereits etwa 25'000 Schaulustigen das Vorrundenspiel der Feldhandballweltmeisterschaft 1963 Schweiz gegen USA stattgefunden. Neu gab es gedacht für die Bewohner des hinteren Kleinbasels und Riehens sowie der badischen Grenzgegend ein 'Sportbillet Badischer Bahnhof und zurück' für 80 Cts.)
4.9.1974 Länderspiel - Schweiz vs. Deutschland 47'195 Zahlende (im Eintrittspreis war erstmals auch der BVB-Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt an eine beliebige Haltestelle enthalten)
31.5.1969 Meisterschaft NLA - FC Basel vs. Lausanne-Sports 44'732 Zahlende
19.5.1957 WM-Qualifikationsspiel - Schweiz vs. Schottland 44'027 Zahlende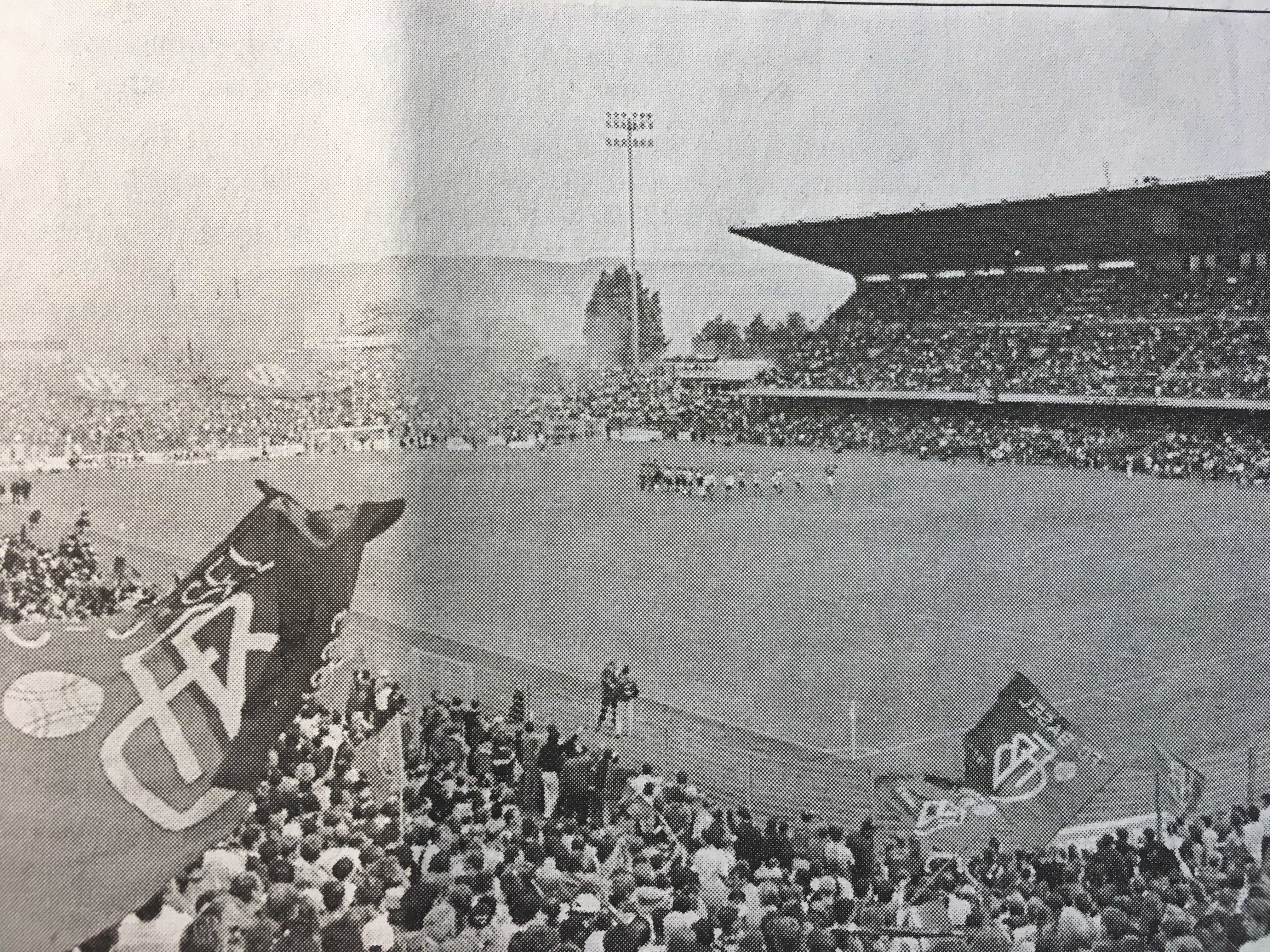
St. Jakob-Park 15.3.2001 (Neubau Stadion St. Jakob) 33'433 Plätze (30'200, bzw. 31'539 ohne Stehplätze) - Spielfeld 105 x 68 m
Erste Mantelnutzung einer Schweizer Sportstätte mit Shopping Center (Eröffnung mit damals 33 Geschäften am 1.11.2001), Seniorenresidenz. Einstellhalle für 680 Fahrzeuge: als Vater dieser Arena der Neuzeit, die dem FC Basel gegenüber Bern, Zürich oder Genf für ein paar Jahre einen Standortvortel verschaffte, gilt der Bauunternehmer Stephan Musfeld.
An den Eingängen wurden Drehkreuze für die Öffnung mittels Steckkarten-System montiert. Oberhalb der Tore wurden auf beiden Seiten zwei 45 Quadratmeter grosse elektronische Monitore für Bewegtbilder aufgehängt. 180 Scheinwerfer sorgten mit einer Gesamtleistung von 140 Lux für das Licht.
Die Stadiontaufe fand am 7.9.2001 zusammen mit der Einweihung der fertig gebauten Haltestelle Basel St. Jakob statt.
Nach negativen Erfahrungen wurden im Stehplatz-Besuchersektor ab dem dritten Spiel Sitzplätze montiert. Ausschreitungen von Gästefans beim WM-Qualifikationsspiel Schweiz vs. Jugoslawien vom 1. September 2001 führten für internationale Spiele mit erhöhtem Risiko zur Verabschiedung weiterer Massnahmen. Beim letzten Heimspiel der Saison 2001/02 trennte die Zuschauer der Sektoren B, C und D erstmals eine am 6.5. installierte, 1,13 m hohe Metallabsperrung vom Spielfeld. In Anlehnung an die Vorschriften der Uefa und Fifa wurden aufgrund verschiedener internationaler Spiele ab August 2002 im gesamten Stadion vorübergehend auch für Spiele des FC Basel erstmals nur Sitzplätze angeboten. Für die CL-Partien gingen durch Sicherheitsabstände und der Belegung einiger Plätze durch das Fernsehen 700 Sitze auf eine Kapazität von insgesamt noch 29'500 verloren (Gästesektor 1'500). Als es am 1. Dezember 2002 beim Spiel gegen den Grasshopper Club auch in der Muttenzerkurve zu unschönen Vorfällen kam, führte der FC Basel eine Sitzplatzpflicht vorübergehend (bis Februar 2004) auch für seine eigenen Fans ein.
Am 2. März 2002 bot die SBB anlässlich des Spiels gegen den FC Zürich erstmals einen Shuttlezug vom Hauptbahnhof zum Stadion an (16.06 Uhr Bahnhof SBB, Rückfahrt 18.45 und 19.30 Uhr). Der erste SBB-Joggeli-Shuttle war bereits bei der offiziellen Eröffnung des Stadions am 7.9.2001 um 18.43 Uhr ab Bahnhof SBB unterwegs. Ein neuer, 9000 m2 grosser Rollrasen war erstmals am 27.3.2002 fertig verlegt.
U21-EM 2002 (Spiele in Basel): Italien - Portugal 10'100, Italien - England 12'980, Schweiz - Italien 30'000 av. (Gruppe A), Schweiz - Frankreich 26'300 (Halbfinals), Tschechien - Frankreich 20'400 (Final).
Auf die Europameisterschaft 2008, die an die Schweiz und Österreich vergeben wurde, erhielt die Gegentribüne mit dem Sektor G eine Galerie und einen erhöhten dritten Rang, deren Fassade durch länglich angeordnete transluzente Folienkissen mit 24 Metern Länge und vier Metern Höhe zur Autobahn gerichtet in verschiedenen Farben abwechselnd den FC Basel sowie die Stadt Basel bewerben. Die Eröffnung fand am 15. November 2006 zwischen der Schweiz und Brasilien vor 39'000 Besuchern statt. Vor der Muttenzerkurve entstand eine Plattform und ein 71 Meter hoher Büro- und Wohnturm.
EM 2008 (Spiele in Basel): Schweiz - Tschechien 39'730 av. (Eröffnungsspiel), Schweiz - Türkei 39'730 av., Schweiz - Portugal 39'730 av., Deutschland - Portugal 39'374 av. (Viertelfinals), Russland - Holland 38'730 (Viertelfinals), Deutschland - Türkei 39'374 av. (Halbfinals).
Nach der EM wurde das Fassungsvermögen, das durch eine Verdichtung der Sitzabstände von 50 auf 45 cm weitere Plätze dazugewonnen hatte, schrittweise wieder auf schliesslich 36'000 reduziert.
2024 wurde die alte Flutlichtanlage durch ein LED-System ersetzt.
Rechtsform: Genossenschaft. Die Betreiber- und Vermarktungsgesellschaft 'Basel United' wurde 2013 von der FC Basel 1893 AG übernommen: im Gegenzug erhöhte sich die Stadionmiete für den Club auf 3,8 Millionen Franken pro Jahr zusätzlich einer Million bei Champions-League-Teilnahmen. Neues Nutzungsmodell 2023 mit einer Mietreduktion auf 1,65 Millionen Franken.
Frauen-EM 2025 (Spiele in Basel): Schweiz - Norwegen 34'063 av. (Eröffnungsspiel), Deutschland - Dänemark 34'165 av., Frankreich - Holland 34'133 av., Deutschland - Frankreich 34'128 av. (Viertelfinals - erstmals mehr Frauen als Männer bei einem Spiel im Joggeli), England - Spanien 34'203 av. (Final).
Im Sommer 2025 wurden die vier unteren Sitzreihen im Sektor C für LED-Werbebanden aufgehoben.
FC Basel
Zuschauerrekord: 7.6.2008 Schweiz vs. Tschechien - Europameisterschaft-Endturnier 39'730 av.
Leichtathletik-Stadion St. Jakob Kapazität 5'060
Das mit Rampen umgebene, als Abgrenzung zum geplanten Kampfstadion konzipierte 'Übungsstadion' als damalige Hauptanlage der Sportanlagen St. Jakob wurde erstmals am 4. Oktober 1936 mit der Schweizer Cup-Begegnung SC Olympia - FC Wädenswil für ein Fussballspiel freigegeben und bereits eine Woche später vom FC Concordia genutzt, der damals in der zweithöchsten Klasse spielte
„Mit schwarzen Zipfelmützen die einen, mit wärmenden Handschuhen und wollenen Halstüchern die anderen, so präsentierten sich die Spieler auf dem schneebedeckten Leichtathletik-Stadion St. Jakob am kalten Sonntagmorgen. Dass mit solcher Vermummung kein unbeschwertes Spiel zu erwarten war, versteht sich um so mehr, als auch der unberechenbare Boden nicht zu übermütigen Purzelbäumen einlud“ (als in Basel noch General Winter herrschte [I], und in der kalten Jahreszeit bei Minusgraden und auf gefrorenen Böden noch Fussball praktiziert wurde: 2. Liga-Spielbericht FC Breite - FC Laufenburg 1:0, NZ 23.12.1963)
Neue Beleuchtungsanlage 16.8.1967 (FC Breite - SC Burgdorf).
Eröffnung Neubau am 31. Oktober 1984 mit acht Laufbahnen inklusive vier 45 Meter hoher Beleuchtungstürme. Der auch dem Schulsport wertvolle Dienste leistende Ort anstelle des für den 'Markt' der Grün 80 eingeebneten alten Stadions galt nach dem politischen Scheitern des Tribünenprojektes von 1980 wegen seiner prekären Infrastruktur und ohne Schutz vor Regen oder Hitze als nicht fertig und zuschauerunfreundlich. Zwei kleine Umkleidekabinen, welche 1997 um zwei Container als Garderoben neben dem Stadion ergänzt wurden, waren provisorisch in die Stehrampen integriert. Auch der Platzspeaker agierte aus einem Container.
Kapazität Nordrampe ca. 5'000 Besucher, Spielfeld 100 x 68 m. Erstes Fussballspiel am 8.9.1984 FC Basel - Vevey Sports (Nachwuchsmeisterschaft).
Zuschauerrekord: 2.6.2001 FC Concordia - FC Schötz - 1. Liga Playoffs ca. 2'500 (Gratiseintritt)
FC Concordia (erstes Meisterschaftsspiel 23.9.1984: „nicht wenige Zuschauer benützten das Parkhaus St. Jakob als praktische und auch - in Anbetracht der Regengüsse in der zweiten Halbzeit - als sehr nützliche Gratistribüne. Die rund hundert Kiebitze sahen sich aus dieser erhöhten Lage das Spiel gratis und erst noch 'trocken' an“ - Matchbericht Basellandschaftliche Zeitung)
FC Basel II
SC Baudepartement (nach Verlust des Satusgrund, später Rankhof)
Eröffnung Neubau am 23. März 2015. Auf der Südseite wurde mit 480 Sitz- sowie 20 Kommentatoren- und Presseplätzen eine 1984 aus Kostengründen zurückgestellte Tribüne mit den bislang fehlenden Garderoben und Infrastrukturräumen realisiert. Gleichzeitig wurde das Stadion saniert.
Kapazität ca. 6'000, Spielfeld 100 x 64 m.
Zuschauerrekord: 7.2.2024 FC Basel U19 - FC Bayern München U19 - Uefa Youth League Playoffs 4'523
FC Concordia (Platzclub)
Sportplatz Landhof 26.11.1883, 16.11.1902
Dem FC Basel wurde 1893 das 20'000 Quadratmeter umfassende Landhof-Areal unentgeltlich zu Verfügung gestellt. Gespielt wurde auf einer Wiese längs der Riehenstrasse, wo 1897 im Innenraum einer Radrennbahn ein Fussballfeld entstand. Dieses 'Vélodrome de Bâle' war von 1895 bis 1901 in Betrieb. Nach dem letzten Rennen am 25. August brach man die Holzpiste und die Zuschauertribüne ab und liquidierte anfangs November den 'Verein Basler Rennbahn'. In der Mitte des Platzes entstand für kurze Zeit eine Kegelbahn, bis im Herbst 1902 der FC Basel dank dem neuerlichen Entgegenkommen der Besitzerin wieder Benutzer wurde. Das Landhof-Areal ging am 29.8.1938 in das Eigentum der Einwohnergemeinde Basel über.
„Unserem sportliebenden Publikum ist zum Trotz dafür, dass sich bei uns in Basel keine Rennbahn mehr befindet, Gelegenheit geboten, auf dem schönen Landhof für ein kleines Eintrittsgeld höchst interessanten Fussball-Wettspielen beizuwohnen: es bietet dies in seiner Art gewiss noch mehr Reiz als das Rennen, besonders wenn man das Spiel etwas kennt. Manch drollige Szene bringt den Zuschauer zum Lachen: dann aber gibt es auch recht ernste Momente, wo jeder Spieler sein ganzes Können einsetzt“ (Vorschau FC Basel - FC Old Boys, BN 1905)
Zum Länderspiel der ab 1906 umzäunten und dann durch eine zwei Meter hohe Bretterwand abgedichteten Matte stand am 5. April 1908 gegen Deutschland wieder eine neue, 200plätzige Tribüne offen, was vom Verband für die Vergabe des Länderspieles nach Basel ausbedungen worden war.
Benutzerordnung 1908: 'Die Spieler haben das Spielfeld in corpore zu betreten (Artikel 2). Unmittelbar vor den Wettspielen ist das Üben auf dem Rasen nicht erlaubt (Artikel 3). Helle Strümpfe sind tunlichst zu vermeiden (Artikel 4). Kritiken an Mitspielern sind erst nach dem Matche anzubringen: alles unnötige Reden während des Spieles soll vermieden werden'.
„Der gute alte Landhof, auf dem sich die Schweizer in ihrem fünften Länderspiel am 20.5.1909 von den Engländern hoch 0:9 bodigen liessen, hatte noch keine Stehrampen, so dass die Menschen im Hintergrund alle möglichen Utensilien herbeischafften, um sich die Beine zu verlängern“ (Tip-Sportmagazin 13.8.1963)
„Es ging gegen den Frühling zu. Auf dem Spielfeld lagen, da und dort hingestreut, einige Flecken schmutziggrauen Schnees. Und vor dem einen Tor, dem gegen die Riehenstrasse zu, breitete sich, so um die Elfmetermarke herum, ein kleiner, zu solidem Eis erstarrter Weiher aus. Unsere Mannschaft, der ich diesmal als Mittelstürmer eingegliedert worden war, spielte zuerst gegen das andere, das sogenannte obere Tor. Vor diesem aber war alles bodenlos. Der Ball - hatte man ihn erst einmal in den Sumpf hineinmanövriert - konnte unmöglich noch weiter vorangebracht werden. (...) Wir lagen mit zwei Treffern im Rückstand als die Seiten gewechselt wurden. Freilich lange ging's nicht, so war bereits der Gleichstand erreicht. Denn die harte Decke des Eisweiherleins erwies sich als geradezu ideale 'Abschussbahn' für den richtig daherkommenden Ball. Wenn die beiden Flügelstürmer die Kugel gut abgemessen zur Mitte bringen konnte, so brauchte man auf dem Eisparkett bloss den Fuss im Moment des Aufprallens gegen den Ball zu bringen - dann flog dieser unheimlich scharf gegen das Holzgestänge zu (...) Wohl gab es nicht bei jedem 'Abschuss' einen Erfolg. Aber achtmal gelang den beiden Flügelmännern und mir dieses Spiel zum und vom Eis nach Wunsch“ (Erinnerungen von Hermann Schmiedlin vom Spiel einer der unteren Mannschaften seines FC Nordstern gegen die Reserven des FC Basel, ca. 1909)
Die durch zwei lange Seitenflügel erweiterte Tribüne wurde am 4.7.1920 eingeweiht („der Besucher findet eine auf 1'500 Sitzplätze vergrösserte, gedeckte Tribüne, die nun die grösste ihrer Art in der Schweiz sein wird und die allen Zuschauern einen Überblick auf den Spielplatz gestattet“)
„Das Publikum sei ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass laute Zurufe beleidigender Art an Spieler und Schiedsrichter strenge verboten sind. Die Vereinsleitung des FC Nordstern behält sich ausdrücklich vor, unbotsmässige Elemente des Platzes zu verweisen, um derart sportschädigende Vorfälle, wie sie sich letzten Sonntag (FC Basel - BSC Young Boys) ereigneten, zu vermeiden“ (Vorschau 1922)
Zuschauerrrekord (Meisterschaft): 30.3.1924 FC Basel vs. BSC Young Boys 6'300 („auf dem Landhof ist Grosskampfstimmung. Eine grandiose 7'000 köpfige Menschenmenge umsäumt schwarz den Platz“ - BN)
Stadion Landhof 5.10.1924
(„der Landhof bietet einen ungewohnten Anblick: dass um drei Meter verbreiterte Spielfeld trägt einen prächtig grünen Rasen, rings herum zieht sich eine solide Bretterwand, und auch die Zuschauerrampen sind neu terrassenförmig stark erhöht angelegt worden“ - Basler Nachrichten 6.10.1924)
Auf die Saison 1930/31 wurde das Terrain durch die Erstellung eines Häuserblocks auf der Südseite etwas zur Riehenstrasse hinunter verschoben. Am Sonntagabend des 2. November 1931 fiel die hölzerne Tribüne einer Brandstiftung zum Opfer. Schliesslich bot dieser alte Landhof nur noch 700 Sitzplätze.
Zuschauerrrekord (Meisterschaft): 10.4.1949 FC Basel vs. FC Lugano 11500
Stadion Landhof 18.8.1951 14'808 (Stehplätze 13'550, Tribüne 1'258) - Spielfeld 105 x 70 m
Die Längslinie des verschobenen Hauptfeldes kam parallel zur Peter-Rot-Strasse zu liegen. Der Zu- und Abgang wurde über drei Ein- und Ausgänge mit achtzehn Kassenhäuschen sowie einem zusätzlichen vierten Ausgang abgewickelt. Die Stehrampen bestanden aus zehn Stufenreihen. Die Anlage mit zusätzlich einem halben Trainingsplatz hinter der Tribüne („von wo aus geradezu ein 'englischer Blick' gewährt wurde“), die für die Mannschaftsaufstellungen, Zwischenresultate und die Durchgabe von Reklamen während der Pause neu über eine privat finanzierte Lautsprecheranlage verfügte („zur 2. Halbzeit empfing der Radezki-Marsch der wieder in Betrieb genommenen Lautsprecheranlage die Spieler“ - Spielbericht FC Basel II - FC Münchenstein 18.5.1953 NZ), war mittlerweile komplett von einer Blockrandbebauung umschlossen.
Zuschauerrrekord (Schweizer Cup-Halbfinal): 23.3.1952 FC Basel vs. Grasshopper Club Zürich 14800: „da wir aber auf den Terrassen und an den Fenstern der umliegenden Häuser noch gute 800 [Zuschauer] gezählt haben, so wohnten diesem Cupgame mehr Interessenten bei als einem Eishockey-Länderspiel auf der Basler Kunsteisbahn“ (NZ 26.3.1952). Die Stehrampen und die Tribüne waren schon eine gute Stunde vor dem Spiel voll besetzt. Vorgängig fand ein Handballspiel zwischen dem TV Kleinbasel und Länggasse Bern statt (!). Wegen der grossen Nachfrage hatte der FC Basel eine Vortribüne mit 800 Sitzplätzen erstellen lassen und die Besucher dazu aufgerufen, die Besetzung von der Mitte der Sektoren aus zu vollziehen und neben dem Haupteingang auch die übrigen Eingänge zu benützen.
„Dass das mit guten 10 cm Schnee bedeckte Terrain des Landhofs mitnichten vorbereitet worden war, wodurch manch urkomische Situation entstand und der altehrwürdige Spitzkick wieder einmal bevorzugte Verwendung zu finden vermochte“ (als in Basel noch General Winter herrschte [II], und in der kalten Jahreszeit bei Minusgraden und auf gefrorenen Böden noch Fussball praktiziert wurde: Freundschaftsspiel FC Basel - SC Kleinhüningen 5:2, NZ 27.1.1958)
1964 wurde Michel Groh, der unweit an der Clarastrasse aufgewachsen war, für ein Vierteljahrhundert als Platzwart und Materialverwalter geehrt.
„Dass bei dieser Gelegenheit Erinnerungen vom lieben alten 'Ländi' ausgetauscht wurden, versteht sich (...) Mit seinen kaum zwanzig Lenzen zählt die 12'000 Zuschauer fassende Anlage bezüglich Publikumskonfort eindeutig zur Basler Spitzenklasse, nicht zuletzt deshalb, weil die Sitzbänke eindeutig bequemer sind als beispielsweise die Schalensitze auf der Schützenmatte. Dann kommt die Nähe der Mustermesse - in diesen Tagen ein eigentlicher Publikumsmagnet - als eminenter Vorteil“ (Schweizer Cup 1/16 Finals FC Basel vs. FC Martigny-Sports - BN 7.11.1972)
Nachdem der vor den beiden Toren stets schadhafte Rasen im Sommer 1978 durch die Montage von Kunststoffrasenstücken in den Strafräumen saniert worden und der FC Basel, der damit als erster NL-Verein auf einer solchen Unterlage trainieren konnte, zu einem Allwetterplatz gekommen war, verbot der Verband aus Sicherheitsgründen (Verletzungen) die Austragung von Wettspielen und der Landhof konnte nur noch als Trainingsplatz und nicht mehr als Publikumsstadion genutzt werden. Später wurde der Kunststoff wieder entfernt. Die jährlichen Unterhaltskosten für den Verein betrugen über 100'000 Franken.
1998 wurden die Tribüne geputzt und die Garderoben und die Stehrampen gesäubert, um den in Vergessenheit geratenen Landhof als Sportzentrum wieder zu einer Begegnungsstätte zu machen. 2001 wurden diese Pläne sistiert, als der FCB mit dem neuen Stadion auch seinen Juniorenbetrieb und sämtliche anderen Aktivitäten auf das St. Jakob in die Brüglinger Ebene auslagerte (zwischen der Einwohnergemeinde der Stadt als Baurechtgeberin und dem Club war 1947 ein Vertrag abgeschlossen worden, welcher mit der Konzentration sämtlicher Aktivitäten auf den Sportanlagen St. Jakob per 1. Juli 2001 sein Ende fand).
2003 waren auf dem Landhof, wo auch die Veteranen des FC Basel unter der Leitung von Helmut Benthaus ihre Trainings abhielten, inklusive der Frauen zehn Teams des BSC Old Boys eingemietet.
Am 1.5.2004 (bis 2017) nahm auf dem Landhof als Ergänzung zum Vereinsfussball die 1. Basler Alternativliga 'Unseri Liga' mit zwanzig von dreiunddreissig angemeldeten Teams ('organisatorische Gründe') ihren Spielbetrieb auf. Der 'Fussball auf Halbmast' - „halb so ernst, halb so verbissen“ - wurde am Samstagnachmittag gespielt („wir geben den Teams die Möglichkeit, auf der Kultstätte Landhof in einem 'richtigen' Ligabetrieb um Punkte zu kämpfen. Zudem spielen wir - im Unterschied zu einem Grümpelturnier - mit 11er-Teams während 2 x 40 Minuten auf einem Grossfeld“). Am 1.6.2019 startete als Nachfolger die 'Alternative Fussballiga Basel'.
Herbst/ Winter 2022 bis Frühjahr 2023 2022 wird das Tribünengebäude saniert, nachdem sämtliche Umnutzungspläne der Anlage zugunsten einer niederschwelligen Nutzung gescheitert waren. Dabei wurden die letzten alten Tribünenbänke abgebaut.
„'Dr Ländi', wie er im Volksmund heisst, der Landhof des FC Basel, dürfte zu den ältesten schweizerischen, vielleicht sogar kontinentalen Sportanlagen gehören. Seit bald sechs Jahrzehnten, genauer gesagt seit 1893 wird auf jenem Grund und Boden, der einst noch ausserhalb des Stadtkerns lag, gekickt. Allerdings, es gab zwischenhinein einen kurzen Unterbruch, eine dreijährige Periode, da die Fussballer den Radrennspezialisten, die auf dem Areal eine Piste errichtet hatten, weichen mussten. Doch Anno 1902 kehrten die Freunde des runden Leders wieder dorthin zurück (...)
Mancherlei Modifikationen wurde die Anlage unterworfen. Erst war lediglich die nackte Fläche da, mehr oder weniger glatt, mehr oder weniger grasbewachsen. Bald wurde ein erstes, primitives Umkleidelokal angefügt, noch später kam eine bescheidene Tribüne dazu. Als die Zuschauerziffern wuchsen, wurden Rampen gebaut. Dann wieder ein Stück Tribüne, neue, erhöhte Rampen. Und so fort, alles partienweise und allmählich. Bis das Ganze den heutigen Anforderungen nicht mehr genügte, eben weil es Stückwerk war. Inzwischen ist in aller Stille ein kleines Stadion entstanden, ein wahres Schmuckstück: nicht zu mächtig, doch gerade recht in den Ausmassen“ (m.e. zum neuen Landhof - Tip, Schweizer Sportmagazin 14.8.1951)
„Dass sich der Samstag-Fussball immer mehr durchsetzt, ist als sehr erfreuliche Erscheinung zu werten. Sobald noch mehr Spielplätze mit Flutlichtanlagen versehen sind, wird der Sonntag noch mehr entlastet. An diesem Wochenende wird genau die Hälfte der vierzehn Nationalliga-Partien am Samstag ausgetragen. Darunter auch das Spiel Basel - Grenchen auf dem Landhof“ (Basler Nachrichten 13.5.1966): bereits anlässlich der Generalversammlung der Nationalliga des SFAV 1950 war ein Antrag des FC Basel eingegangen, im Hinblick auf die Sonntagsruhe die Meisterschaftsspiele 1951/52 jeweils am Samstag auszutragen, was er in seinem Ausweichstadion Schützenmatte ab September 1950 schnurstracks in die Tat umsetzte (der freie Samstag - wie es in den USA schon längst Mode sei - würde mit der Zeit ohnehin Wirklickeit, hiess es dazu in einem befürwortenden Leserbrief. Eine andere Stimme meinte dagegen pointiert, nur drei Kreise für den Samstagssport zu kennen: die protestantische Kirche, den General und den FC Basel [General Guisan hatte in mehreren Referaten den Zerfall der Familie gegeisselt und diesen mit dem Sport am Sonntag in Verbindung gebracht: der Anspruch der Kirche sei unbestreitbar und der Sportsmann solle einen Tag der Woche gänzlich seinen Liebsten widmen, forderte er])
FC White Stars
FC Basel (bis 1967 - Urstätte des Clubs im späteren Wettsteinquartier)
FC Breite (erste Mannschaft ab 1960 auch Buschwylerhof (Gastrecht), Rankhof und Schützenmatte. 1968 bis 1971 dank dem Entgegenkommen des FC Basel Landhof, bis der FC Concordia den Platz beanspruchte. Mit der Fertigstellung der Sportanlage Schützenmatte 1971 bekam der FC Breite die Erlaubnis, Wettspiele der ersten Mannschaft im neuen Stadion auszutragen, wobei er ab und zu auch ins Leichtathletik-Stadion auswich. 1977 bis 1979 nach Abstieg in die 3. Liga Sportanlagen St. Jakob. Ab 1979 und dem Wiederaufstieg Gastrecht auf dem Rankhof, später wieder St. Jakob sowie Bachgraben und Hörnli). Untere Mannschaften Sportanlagen St. Jakob.
Ab 1934 Landhof und St. Jakob. 1932 bis 1934 Sportplatz Luftmatt. Ab 1923 Sportplatz Birsfelden bei der reformierten Kirche bis 1929 (Eingang Kirchstrasse). Terrain in der Hard Birsfelden ab Saison 1921/22. Spielplatz Schänzli (Cementröhren Christen). Sechstes Terrain ab November 1911 beim Gotthelfschulhaus (Gottfried-Keller Schulhaus). Fünftes Terrain ab 1910 an der Grenzacherstrasse bei der Eisenbahnbrücke. Vierter Spielplatz 1910 an der Zürcherstrasse (Rossmatte). Beginn Saison 1909/10 Terrain auf dem Schlachtfelde bei St. Jakob. Zweiter Spielplatz 1909 an der Rheinstrasse Birsfelden. Erstes Terrain 1908 Alt-Breiteweiher Breitemühle als Matte des entwässerten Breiteweihers.
FC Concordia (70er Jahre, andere Plätze siehe oben)
Der Unterbau der Tribüne enthielt Garderoben für sechs Mannschaften, Wasch- und Duschräume, Schiedsrichter- und Sanitätszimmer, Geräteräume, eine Wohnung für den Platzwart und ein grosszügiges Restaurant (Basler Stadtbuch 1996)
In den Jahren nach der Eröffnung wurde der Rankhof, der hinter der Tribüne parallel über ein 90 x 60 m grosses Trainingsfeld für Fussball und Hockey (B-Feld), ein Übungsfeld für Leichtathletik und ab 1928 östlich anschliessend Richtung Rhein insgesamt über drei Spielfelder verfügte (der C-Platz auf einer ehemalige Müllhalde ist der heutige Parkplatz), nach und nach fertiggestellt. Die Zuschauerrampen wurden so ausgebaut, „dass nun auch bei einer Rekordzuschauermenge jedermann von seinem Platze aus jede Spielphase auf das genaueste verfolgen konnte“ (Herbst 1925). In einer Ecke des Stadions stand ab 1927 neben der grossen Platzuhr ein Omega-Zifferblatt mit 45 Minuten-Einteilung, dessen Uhrwerk sich mit dem Anpfiff in Bewegung setzte. Für die Bekanntgabe der antretenden Mannschaften prangte anstelle der ausser Kurs gekommenen Programmhefte beim Tribünen-Haupteingang ein schwarzes Brett, auf dem kurz vor Beginn die Aufstellungen aufgeschrieben wurden (die Spielernummerierung wie auch der weisse Ball existierten damals versuchsweise nur in England).
1950 wurde die Westrampe für eine bessere Sicht und ein bequemeres Stehen neu in Zementrampen erstellt. Am 6.11.1954 konnten vis-à-vis der Tribüne die mit dreizehn Stufen ebenfalls in Eigenregie betonierte Ostrampe und genau ein Jahr später unterhalb der Totomat-Tafel die Ausbauarbeiten an der nördlichen Stehrampe beendet werden.
Renovation Garderoben- und Duschenanlagen 1957.
25.5.1958 anschliessend an das B-Feld im Ostzipfel der Anlage mit der früheren Leichtathletikwiese Einweihung des neuen Landhockeyfeldes, das 1941 zufolge 'kriegswirtschaftlicher Verfügung' geräumt hatte werden müssen.
„Mit der Flutlichtanlage auf dem altehrwürdigen Rankhof ist es so eine Sache. Schon manches Spiel wurde dort am Rande der Dunkelheit zu Ende gespielt. In der 2. Liga musste der FC Nordstern beim Heimauftritt gegen Breitenbach die nationalliga-fähige 800-Lux-Anlage in Betrieb nehmen. Was allein schon die Kleinigkeit von 800 Fränkli kostet. Und wenn die Anlage voll aufgedreht wird, gehen im Hochhaus neben dem Rankhof, wo auch Regierungsrat Karl Schnyder wohnt, die Lichter aus“ (Basellandschaftliche Zeitung 27.8.1992)
Die Trainingsbedingungen galten für einen Nationalliga-Club als unwürdig: da das Hauptfeld meistens geschont werden musste, stand ihm am Bahndamm mit seiner dornigen Böschung nur der kleine, holprige Nebenplatz zur Verfügung, auf dem auch sämtliche Juniorenmannschaften ihre Einheiten durchführten. Dann musste im August 1985 nach der Brandkatastrophe im Stadion der mittelenglischen Stadt Bradford mit über 50 Toten aus feuerpolizeilichen Gründen auch noch die alte Holztribüne, unter der sich die Restaurantküche befand, gesperrt werden:
„Das Trainingsfeld hinter der Tribüne glich bis vor kurzem eher einer mit Unkraut überwucherten Sandwüste als einem Fussballplatz“ (Andreas Schluchter, BaZ 23.8.1988)
„Leider sind die sanitären Anlagen - mit Ausnahme der Duschen, die in verdankenswerter Weise von unserem Gönnerclub 99 neu erstellt wurden - in einem erbärmlichen Zustand. Umziehkabinen, Materialräume, Toilettenanlagen sind in einem solch schlechten Zustand, dass wir uns jedesmal vor unseren Gastmannschaften schämen müssen“ (Club-Journal 1990/1)
„Früher, in der NLA, mussten wir uns schämen für unsere Tribüne und die zwei - münzbetriebenen - Duschen, die funktionierten“ (Spielerstimme)
Letztes Heimspiel 18.10.1992 (FC Nordstern - FC Frenkendorf, 2. Liga). Tabula rasa auch für die Gartenwirtschaft, die seit 1996 neuen Gegebenheiten im Zweckstil dienen nicht einmal mehr als Erinnerung.
Der Rankhof ging auf die Initiative seines damaligen Präsidenten und späteren Grossrats August Sennrich zurück. Als Nordstern anfangs der 50er-Jahre in einer Finanzmisere steckte, wurde auf sein Ansinnen unter Mithilfe von Ernst Hess die Genossenschaft Stadion Rankhof gegründet (1953). Von der Turn- und Sportkommission erhielt sie für die Ablösung der dringlichsten Verbindlichkeiten ein Darlehen von 25'000 Franken, welches mit Zins und Zinseszinsen Ende Dezember 1963 zurückbezahlt war. Der Unterhalt oblag zusammen mit der Hockeysektion und dem Tennisclub den Mitgliedern. Ohne die Fronarbeit der älteren Mitglieder wäre es gar nicht möglich, den Platz ordnungsgemäss zu unterhalten, wurde betont.
FC Nordstern (Platzclub)
FC Breite (andere Plätze siehe oben)
FC Concordia (andere Plätze siehe oben)
Höchste Zuschauerzahlen:
29.11.1931 Schweiz vs. Österreich - Europapokal der Fussball-Nationalmannschaften ca. 25'000 (ausverkauft - „Zwanzig Zuschauerreihen standen in der Nordrampe hintereinander“)
21.5.1945 Schweiz vs. Portugal - Freundschaftsländerspiel ca. 25'000 (ausverkauft - bei Vollauswertung des Rasenumlaufes mit Sitzbänken konnte eine maximale Zuschauerzahl von 25'000 platziert werden)
15.10.1950 Schweiz vs. Holland - Freundschaftsländerspiel 23'200
10.10.1948 Schweiz vs. Tschechoslowakei - Europapokal der Fussball-Nationalmannschaften ca. 23'000
6.11.1932 Schweiz vs. Schweden - Freundschaftsländerspiel ca. 22'000
5.5.1935 Schweiz vs. Irland - Freundschaftsländerspiel ca. 22'000 (rund 21'000 zahlende Besucher („aber nicht nur die Bundesbahnen, sondern auch die Reichsbahn, die Elsässerbahn, die Birsigtalbahn und unsere Tramvorortslinien brachten ungezählte Besucher nach der Stadt. Vom frühen Morgen an wälzte sich eine nicht enden-wollende Schlange von Motorfahrzeugen auf den Zufahrtsstrassen [...] An der Grenzacherstrasse, vom Wettsteinplatz bis fast zum Grenzacherhorn, an der Wettsteinallee, am Allmendweg, an der Bäumlihofstrasse, an der Schwarzwaldallee bis hinunter zum Badischen Bahnhof und an der Bergalingerstrasse waren während des gestrigen Nachmittags rund 1000 Personenwagen, aus der Stadt, der Nachbarschaft und aus allen Gauen unseres Landes parkiert, darunter zahlreiche Autobusse“ - Basler Nachrichten)
14.10.1951 Schweiz B vs. Deutschland B ca. 20'000 (wegen des grossen Interesses aus Deutschland waren im Gebiet der Grenze alle Meisterschaftsspiele bis Freiburg sistiert)
13.4.1930 Schweiz vs. Ungarn Freundschaftsländerspiel ca. 20'000 (18'250 Zahlende sowie Ordner-, Presse-, Kommissions- und andere Gratiskarten). Eintrittspreise gegen Holland am 6.5.1928: Tribüne 11 Fr., Vortribüne 6 Fr. 60, Sitzplätze rund um den Platz 4 Fr. 40, Stehplätze 2 Fr. 20, verbilligte Stehplätze (Kinder, Militär usw.) 1 Fr. 10.
Am 28. Juli 1935 war der Rankhof Austragungsort eines Entscheidungsspieles des Mitropokal-Halbfinals zwischen Sparta Prag und Juventus Turin um die damals wichtigste Trophäe im kontinentaleuropäischen Vereinsfußball („so ein Mitropacupmatch eröffnet nicht alle Jahre eine Fussballsaison Basels“). Der auch wegen der zu hoch angesetzten Preise leicht enttäuschende Zuschaueraufmarsch von 6'500 übertraf denjenigen der damaligen Clubspiele dennoch deutlich.

Stadion Rankhof/ Sportzentrum Rankhof-Satusgrund (Neubau Stadion Rankhof) 17./18.8.1996 für rund 8'000 Besucher ausgelegt, Tribüne 900 Plätze (fehlende Fluchtwege auf den Stehrampen entlang des Rheins [„wo friedlich ein paar Familien sitzen und obwohl problemlos auf das Spielfeld geflüchtet werden könnte“ - Pressemitteilung FC Concordia 2009] und die ungenügenden Ausgänge links und rechts von der Haupttribüne waren neben der fehlenden Sektorentrennung zu Challenge-League-Zeiten Teil eines geforderten Massnahmenkataloges durch die SFL; mittlerweile ist die Kapazität durchgängig auf maximal 2'310 Besucher beschränkt worden) - Spielfeld 100 x 64 m
Teil des Gesamtkomplex Rankhof-Satusgrund mit sieben Fussballfeldern am südlichen Rand des Hirzbrunnenquartiers
1994 wurde von den Vereinen ASV Basel-Ost, ATV Neue Sektion, FC BVB, Satus Ski Club, SC Basel Nord, SC Baudepartement, SV Rapid und FC Nordstern die IG Vereine Sportanlagen Kleinbasel Rankhof/ Satusgrund gegründet.
Die Sporthalle (Handball, Volleyball, Unihockey) kam später dazu und wurde am 22.9.2002 eröffnet.
Das bei Anlässen übliche Parkieren auf dem Trottoir entlang der Grenzacherstrasse wurde im August 2004 offiziell untersagt, nachdem bei einem Challenge League-Spiel des FC Concordia gegen die AC Bellinzona mit für den Verein ungewöhnlich vielen Zuschauern rund um das Stadion das 'reinste Chaos' ausgebrochen war. Daraufhin richtete der Club einen BVB-Shuttlebus vom Parkhaus aus des Badischen Bahnhofs ein. Später gab die Polizei für die Congeli-Spiele das Trottoir wieder frei.
In der Saison 2004/05 musste der FC Nordstern drei Heimpartien der 2. Liga interregional mit Gratiseintritt auf das Feld 3 verlegen, weil der Hauptplatz gesperrt war.
„Mich persönlich ärgert in erster Linie, dass es dem FC Nordstern verunmöglicht wird, ein eigenes Vereinslokal auf dem Rankhof zu führen. Mit Wehmut denke ich immer wieder an die alte Holztribüne und das Clublokal. Nicht, dass uns nur die Chance entgeht, während des Jahres einiges an finanziellen Mitteln für den Verein zu generieren, vor allem dient ein eigenes Vereinslokal der Stärkung des Vereinslebens, was für die Nachhaltigkeit jedes Vereins ungemein wichtig ist (...) Weiter erhalten wir auch vom Betreiber des Kiosks auf dem Rankhof keine Unterstützung, obwohl der FC Nordstern hier sicherlich der wichtigste Kunde ist. Unser neuer Stammtisch und eine Vitrine für unsere Pokale wurden leider ohne Erklärung aus dem Kiosk entfernt“ (Präsident Oliver Kapp im Cluborgan, April 2022)
FC Nordstern
FC Concordia (NLB/ Challenge League 2001-2009 - Eintritt Stehplatz 15, Tribüne 25 Franken)
SC Baudepartement (vorher Satusgrund und Leichtathletik-Stadion)
Zuschauerrekord: 8.7.2003 FC Basel - Besiktas Istanbul - Alpencup ca. 5'200
Sportplatz St. Margarethen/ Margarethenwiese 1.11.1903 bis 5.3.1922 Tribüne 900 Plätze (Einweihung 22.9.1912 - „zwei tadellose Spielplätze, wovon der eine für die Matches ist, währenddem der andere nur für die Trainings benützt wird“)
Bau Ankleidehütte 1907 („nachdem sich die im In- und Auslande weitherum berühmte Fussballmannschaft zusammen mit dem zweiten und dritten Team bis dahin mit einer einfachen Schutzhütte als Ankleideraum begnügen musste“ - Jubiläumschronik): ein Tribünenunterbau für Garderobenräume exisierte aufgrund dieses separaten Holzbaus nicht.
Am 12.11.1911 trat auf der Margarethenwiese mit einem Trainingsspiel der Basler Hockey-Club an die Öffentlichkeit, welcher in seinen Anfangsjahren das Terrain der Old Boys nutzte. Eine Hockey-Sektion aus 'Mitgliedern, die sich bereits als Fussballer oder Leichtathleten im Club erfolgreich betätigt hatten', besass ab dem 12.5.1921 auch der BSC Old Boys.
Der verbreiterte Platz mit vorgeschobener Umzäunung bis an das Trottoir der Margarethenstrasse, mit dem das Publikum auch von den hinteren Rängen einen freien Blick auf das Spielfeld erhielt, wurde am 31. Oktober 1920 anlässlich der Partie gegen die Young Boys dem Betriebe übergeben. 1921 fiel die Anlage dem Verwaltungsgebäude der IWB zum Opfer.
Östlich des neuen Zeughauses bei St. Jakob konnten von der Christop Merian-Stiftung bis zum Bezug des Stadions Schützenmatte zwei Trainingsplätze gemietet werden („das Terrain hinter dem Zeughaus muss als ausgezeichnet angesehen werden, weil jede Lehmschicht fehlt und man nach Durchdringung einer geringen Humusschicht bereits auf ausgiebiges Schottermaterial stiess“ - Jubiläumschronik)
FC Old Boys (vorher auf der Schützenmatte und an der Thiersteinerallee, nachher Stadion Schützenmatte)
Zuschauerrekord: 10.4.1921 BSC Old Boys vs. FC Biel - Serie A ca. 7'000

Stadion Schützenmatte/ Sportanlage Schützenmatte 6.9.1922 bis 1968 Gesamtkapazität ca. 15'000, Tribüne 1'100 Plätze („rings um die Schlackenbahn ziehen sich die amphithatralisch erhöhten [1,1 m über dem Spielfeld liegenden] Zuschauerplätze hin“: neben Fussball und Leichtathletik kamen auch andere Sportarten wie beispielsweise die Weltmeisterschaft der Kunstturner 1950 zum Zuge) - Spielfeld 100 x 70 m
Der Haupteingang mit maximal acht Kassen befand sich am Wielandplatz: zwei weitere grössere Platzeingänge befanden sich an der Brennerstrasse (Jubliäumschronik).
Die ausgebauten Zuschauerrampen vor allem auf der der Tribüne gegenüberliegenden Seite standen ab dem 1. September 1929 zur Verfügung, womit eine wesentliche Verbreiterung und Erhöhung stattfand: „zunächst sind allerdings nur die Kurvenplätze gegen den Park hin in Angriff genommen worden, die übrigen Rampenarbeiten folgen dann nächstes Jahr. Die sechs Erhöhungen differieren 30 Zentimeter und sind 80 Zentimeter tief, sodass auch bei Regenwetter das Aufhalten der Schirme die Sicht der hinten Stehenden nicht stören wird“ (NZ August 1929)
Mit den zwei Übungsgsfeldern B und C auf einer Fläche von über dreissigtausend Quadratmetern erste Grosssportanlage der Schweiz errichtet auf einem Teil der sogenannten Festwiesen auf der äusseren Schützenmatte, wo einst Schrebergärten standen. Eine Tennisanlage im westliche Teil mit sieben Plätzen und einem 'bescheidenen' Clubhaus wurde am 7.5.1927 offiziell eröffnet.
„Dann können wir auch den Herren vom 'Organisations-Komitee einen Vorwurf nicht ersparen. Dasselbe liess nämlich zwei Spiele auf aneinandergrenzenden Plätzen zur gleichen Zeit austragen und trug natürlich das beständige Pfeifen von hüben und drüben nicht gerade zur Sicherheit der Spieler bei. Auch dass die Zuschauer - es waren ihrer gut 500 - ungehindert die Spielfeldmarke um Meter überschreiten durften, soll nicht unerwähnt bleiben“ (NZ 24.3.1924 - Ausscheidungsspiele in den unteren Serien)
Die technischen Anlagen für die Leichtathletik wurden mit je zwei Hoch- und Stabhochanlagen, Kugelstossfeldern und Weitsprungbahnen 1958 ausgebaut.
Die Tribüne galt beim Abriss 1969 als die älteste der Schweiz. Auch der Zustand der sanitären Einrichtungen war bereits lange vor dem Neubau in einem 'bedenklichen Zustand' und galt 'für kultivierte Leute des 20. Jahrhunderts' als nicht mehr zumutbar, wie diese 'vergilbte Visitenkarte' Basels 1958 in einem Kommentar zu einem Meeting wahrgenommen wurde: als Basler müsse man sich vor den auswärtigen Gästen für die unbequemen Bänke und die Sicht versperrenden Holzpfosten schämen
BSC Old Boys (Platzclub)
FC Breite
Zuschauerrekord: 3.6.1923 Schweiz vs. Deutschland - Freundschaftsländerspiel 15'000 (ausverkauft - einziges Länderspiel auf der Schützenmatte, weil bereits ein Jahr später der grössere Rankhof eröffnet wurde)
Zuschauerrrekord (Meisterschaft): 21.5.1950 FC Basel vs. Lausanne-Sports 14'000 (Ausweichstadion wegen Neubau Landhof und baslerischer Rekordbesuch für ein Meisterschaftsspiel damals)
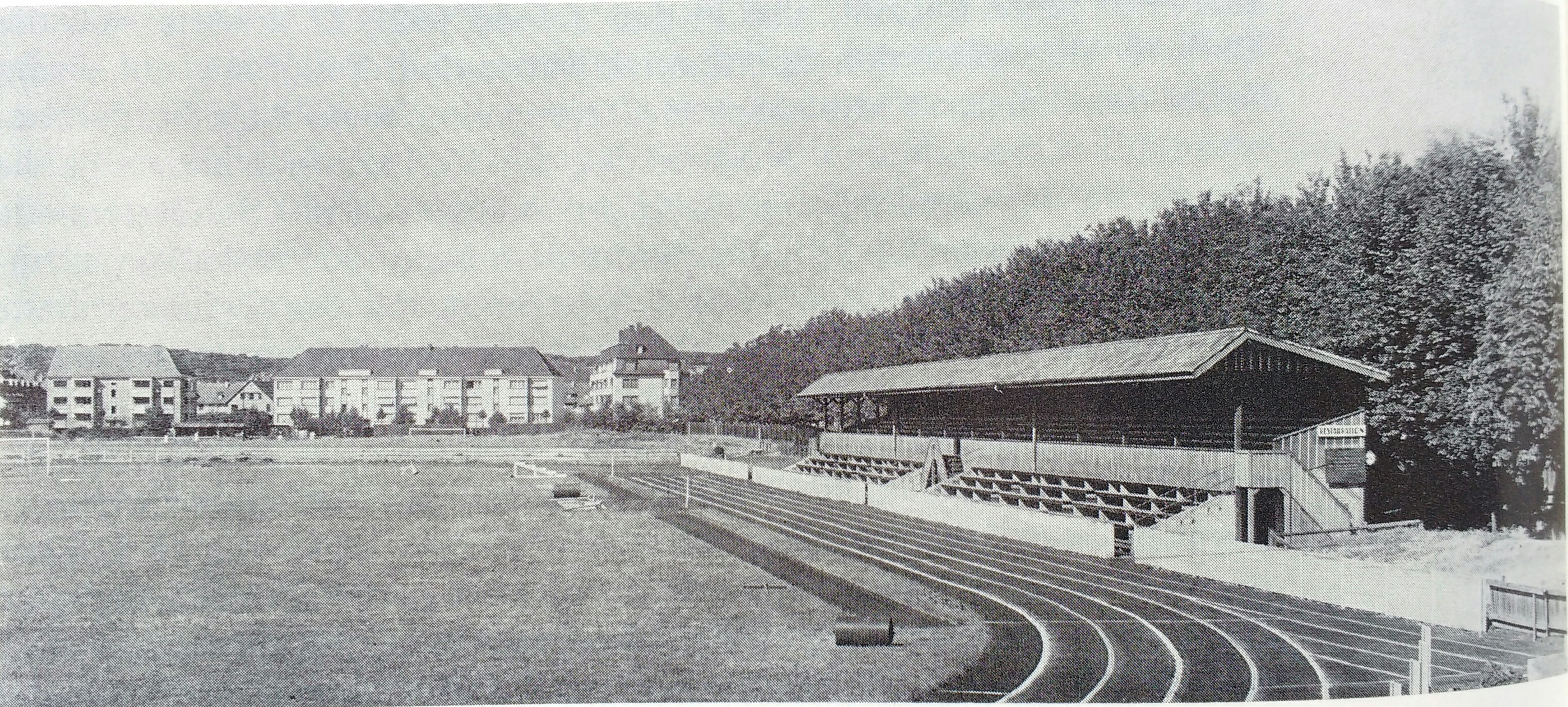
Stadion Schützenmatte 23.7.1971 (Neubau Stadion Schützenmatte als damals grösstes Leichtathletikstadion der Schweiz) Gesamtkapazität 14'800, Tribüne 2'100 Einzelsitze (die Kapazität wurde mehrfach reduziert und beträgt aus Sicherheitsgründen heute nur noch 8'000) - Spielfeld 100 x 64 m
Einweihung Flutlichtanlage am 11. August 1971 mit dem Spiel FC Basel - Karlsruher SC, welche nach dem Aufstieg der Old Boys in die Nationalliga B 1987 aufgerüstet werden musste: OB trug die ersten Wochentagsspiele im Stadion St. Jakob aus.
Die OB-Anlagen waren mit Grossratsbeschluss des Umbaus vom 15. Januar 1965 in den Besitz der Stadt gekommen. Gewisse 'wohlerworbene Rechte' wie die Benutzung des Platzes und die Führung des Tribünenrestaurants blieben dem Verein aufgrund eines Mietvertrages mit der Basler Regierung vom 12.11.1971 mit einem Nachtrag vom 25.9.1975 aber zugesichert, nachdem sich für die Zuteilung verschiedene Interessen gemeldet hatten.
BSC Old Boys (Platzclub)
FC Breite (1971-1977 - mit Beschluss vom 17.8.1971 wurde der 1. Liga-Mannschaft des FC Breite das Stadion Schützenmatte vom Regierungsrat vorerst für eine Versuchsperiode von einem Jahr zugewiesen)
Zuschauerrekord: 29.8.1999 FC Basel vs. FC Zürich - Meisterschaft NLA 11'700 av. (Gratiseintritt Stehplätze).
Eröffnung Umbau, mit dem an die Ära der zwanziger und dreissiger Jahre mit mehrmals bis zu 10'000 Zuschauern angeknüpft werden sollte, am 27. Juli 1985: der Platz wurde um 30 Zentimeter angehoben und die unterste Stehrampe weggespitzt, um den für den Einbau zweier zusätzlicher Laufbahnen benötigten Platz zu gewinnen, womit rund 600 Stehplätze verlorengingen. Kapazität für 14'200 Besucher (12'000 Stehplätze, 2'200 gedeckte Sitzplätze).
Die 'OB-Matte' diente dem FC Basel 1999 und 2000 als Ausweichstadion während des Neubaus des Stadions St. Jakob (Kapazität total 11'700 Plätze, davon Stehplätze 3'300 Allschwilerkurve, auswärtige Gäste 1'600, Rest 4'800. 2'000 Sitzplätze). Dafür wurden der Rasen saniert (der danach bezüglich seiner Qualität auch mal 'Golfplatz' genannt wurde), einige bauliche Anpassungen vorgenommen und insbesondere in ein fernsehtaugliches Licht investiert („wir können jetzt abends auf dem Balkon ohne Licht lesen“ - Anwohner):
„der temporäre Wechsel ins Exil war indes von erheblicher Unruhe geprägt. Ursprung der Unstimmigkeiten war die Bekanntgabe der neuen Eintrittspreise, was einen mittleren Entrüstungssturm auslöste. Obwohl der FCB für die Zeit auf der Schützenmatte vom Baukonsortium mit einem siebenstelligen Betrag entschädigt wird, benützte der Vorstand den Umzug zu einer Quasiverdoppelung - mit der Begründung des begrenzten Fassungsvermögens. Ein Stehplatz-Jahresabonnement für 18 Meisterschaftsspiele kostete 500 Franken oder 30 Franken für den Einzeleintritt, 'falls diese überhaupt noch in den Verkauf kommen', wie es damals hiess. Die Taktik war evident: nach bester 'Swatch'-Methode ein knappes, begehrtes Produkt möglichst rasch ausverkaufen“ (Daniel Hügli, NZZ 6.3.1999). Als Reaktion auf den schwachen Besuch zum Start gegen Neuchâtel Xamax mit nur 4'250 Zuschauern wurden die Ticketpreise in der Stehplatzkurve Richtung St.-Galler-Ring reduziert. Am 26.6.1999 erlebte das offene und entsprechend ungeliebte Rund am Wielandplatz mit dem Uefa-Intertoto-Cupspiel gegen Prevalje Korotan aus Slowenien seine Europacup-Premiere, für welche die Zuschauerkapazität auf 4'335 beschränkt werden musste.
Im Zuge der Euro 2008 wurde das Stadion, welches für Trainingseinheiten genutzt wurde, wieder zur Baustelle. OB musste die 2. Liga interregional-Heimspiele auf Feld B (Kunstrasen) oder C austragen. Der Umbau, bei dem man eine neue Anzeigetafel erhielt, war im Herbst 2007 abgeschlossen.
SPORTANLAGEN, FUSSBALLPLÄTZE GROSSBASEL (linksrheinisch)
Sportanlagen St. Jakob (Brüglinger Ebene - Gemeinde Münchenstein)
Erstellt mit Hilfe des Arbeitsrappens zwischen Dezember 1932 und Sommer 1933, als acht Spielfelder dem Spielbetrieb übergeben werden konnten. Die Einwohnergemeinde hatte von der Christoph Merian Stiftung ein 305000 Quadratmeter grosses Wiesland auf der St. Jakobsmatte erworben.
(Der heilige Jakob, einer der Jünger Jesu, ist Patron der Winzer, Pilger und Reisenden. Ihm wurde eine Kapelle an der ehemaligen Birsbrücke geweiht, zu welchem noch ein Zoll und ein Siechenhaus gehörte. Der geographische Geltungsbereich weitete sich wegen der Schlacht von 1444 auf das ganze Gebiet aus)
„Der Baselstädtische Fussballverband unterer Serien veranstaltet Sonntag, den 15. April 1934, vormittags um 10 Uhr den ersten Grosskampftag auf dem Stadion St. Jakob, welches nun schon so weit vorgeschritten ist, dass acht Mannschaften zur gleichen Zeit ihre Spiele austragen können. Unter diesen besonders günstigen Umständen hat sich die technische Kommission entschlossen, die zweite Hauptrunde des Basler Cups auf den idealen und topfebenen Plätzen spielen zu lassen“ (National-Zeitung)
Die verkehrstechnisch gut erschlossene Anlage in der Brüglinger Ebene, auf die in der Folge ein Fussballstadion, ein Gartenschwimmbad, eine Reitsportanlage, eine Sport- und schliesslich noch eine Eishalle zu liegen kamen, wurde - nachdem wegen der grossen Nachfrage (1953 hatten z.B. 49 Vereine regelmässig hier ihre Trainings abgehalten) selbst die in erster Linie für die Primarschulen gedachte Spielwiese mit Fussball- und Hockeytoren hatte versehen werden müssen, schrittweise und mehr und mehr beleuchtet erweitert und saniert:
1956 südlich der Gartenbadanlage Inbetriebnahme zweier Übungsfelder von 90 x 60 m, eines 103 x 68 m (heutige Nummerierung 18 bis 20) sowie neues Garderobengebäude (F) an der grossen Allee,
am Ort der heutigen Kunstrasenfelder drei zusätzliche Plätze (70er Jahre?),
und als Ausdehnung der Plätze von 1933 in Richtung Süden auf dem Land des Bauernhofs der CMS schon vor der Gartenbauausstellung Grün 80 (Realersatz) vier neue Plätze. Damals waren von den schliesslich etwa zwanzig Plätzen drei sogenannte Tennen-Allwetterplätze.
Über die Beanspruchung erfuhr man im Cluborgan des SC Basler Leben 1961, dass die starke Nachfrage dazu zwinge, nebst dem ausgedehnten Trainingsbetrieb mit damals mehr als 70 Vereinen und dem Schulsport am Wochenende manchmal vier bis sechs Spiele auf dem gleichen Feld zu plazieren.
Beim Leichtathletik-Stadion wurde mit der offiziellen Übergabe am 11.8.1984 das ehemalige Trainingsfeld des FC Basel (Feld 17) wiederhergestellt, das dem Bau des Parkhauses zum Opfer gefallen war, nachdem der FC Basel (der sich bei der staatlichen Verwaltung zunächst jahrelang vergebens um die Ausklammerung von zwei Feldern zu seinen Gunsten bemüht hatte - weil 'eine Sonderstellung oder Zugehörigkeit zu höheren Spielklassen nach dem Grundsatz der Rechtsgleichheit nicht erlauben könne, was anderen nicht gestattet ist') in den späten sechziger Jahren auf Kosten der Landhockey-Spieler einen Trainingsplatz nördlich der Leichtathletik-Anlage zugewiesen erhalten hatte: auch ein 1961 zusammen mit dem FC Breite und dem FC Concordia beim Erziehungsdepartement unternommener Vorstoss, für die drei Vereine drei Felder abzutrennen, war erfolglos geblieben.
Ersatz Garderobengebäude 30. August 1993, weil die 50jährigen 'Holzbaracken' A, B und D nicht isoliert und stark abgenutzt waren.
18.4.1994: der im Winter für Fussballtrainings benutzte Teerplatz gleich neben dem neuen Garderobengebäude an der Grossen Allee hatte sich bis zum Beginn der Herbstferien in einen 45 x 23 m grossen Sandplatz mit drei Beachvolleyballfeldern verwandelt. Danach wurde der benötigte Sand auf den Rasenfeldern verteilt, um ihre Wasserdurchlässigkeit zu verbessern.
2000 bis 2001 wurden die Plätze beim Parkhaus jetzt in Nord-Süd-Richtung in zwei Kunststoffrasenspielfelder umgebaut („wir mussten den Platz noch nie sperren“, Platzwart 2003: allerdings wurden diese immer wieder ausgebessert und standen deshalb zeitweise nicht immer zur Verfügung, ehe dank einer mit der Uefa und der Basel United AG getroffenen Vereinbarung nach der Euro 08, für die dort eine Hospitality-Zone für geladene Gäste entstanden war, ein Kunstrasen der Generation 3.5 verlegt wurde (90 x 55 m - späterer Ersatz 2019). Sie schliessen an die am 12.10.2002 eröffnete Eishalle an. Am 13.3.2010 fand hier 'auf Geheiss des Sportamts' mit dem Derby FC Basel U21 gegen den FC Laufen eine 1. Liga-Partie statt.
Beachsoccer:
15. April 2002 Einweihung 25 x 30 Meter grosse Beach Soccer-Anlage, für die 500 Tonnen Sand nötig waren, mit fünfeinalb Meter grossen E-Junioren-Toren als erste permanente Beach Soccer-Anlage der Schweiz. Kandelaber rund um das Feld machten es möglich, bis spät in den Abend hinein zu spielen. Zusätzlich wurde vom Sportamt im benachbarten Gartenbad St. Jakob zur Vorbeugung eines allfälligen Booms und für die Umrüstung auf Beach-Soccer-Turniere das dortige Beachvolleyball-Feld vergrössert. Am Wochenende des 19., 20. und 21. Juli kam mit einer 1'500-plätzigen Tribüne das erste Schweizer Turnier der European Pro Beachsoccer League unter den Nationalmannschaften aus Deutschland, Norwegen, der Türkei und der Schweiz zur Austragung. Premiere der Swiss Beachsoccer Tour am 13., 14. und 15. Juni 2003 unter der Organisation des FC Black Stars. Am 28.9.2005 ging im Walzwerk der ehemaligen Firma Brown Boveri als Trainingsmöglichkeit für die kalte Jahreszeit eine multifunktionale Halle für Beachsoccer und andere Sand-Sportarten in Betrieb, welche als 'zu klein, zu dunkel und zu teuer' aber bereits im Jahr darauf wieder abgegeben wurde. Eine neue Möglichkeit ergab sich ab August 2006 Im Wasenboden im westlichen Kopf der Basler Strassenbrücke Luzernerring.
Noch heute umfasst die Anlage inklusive dem renovierten Leichtathletikstadion und dem neuen FCB Nachwuchs-Campus zwanzig Plätze.
Diese galten bis zum Bau eigener Einrichtungen auch als Hauptspielstätte für den Firmenfussball.
SC ACV/ SC Coop
(als SC Regio Basel 14.8.1976 bis 1986 in Fronarbeit erstellte Sportanlage Regio/Unterwart im Muttenzer Unterwart-Quartier in der Nähe des Genossenschaftlichen Seminars der Coop Schweiz AG zwischen Rotbergstrasse und Seminarstrasse als befristeter Überlassungsvertrag mit der Wohngenossenschaft Horner: durch die Vermittlung eines Vereinsmitgliedes konnte ein Stück Ackerland erworben werden, das nicht mehr bewirtschaftet wurde, nachdem bereits ab 1968 verschiedene Versuche für einen eigenen Sportplatz unternommen worden waren)
FC Anadolu
FC Baris Spor,
BCO (später Bachgraben und Junioren seit 1989 Bäumlihof, BCO Alemannia Hörnli. SC Olympia Sportplatz Dreispitz, vorher Friedmatt)
FC Basel (untere Mannschaften)
FK Beograd (aus FC Jugos)
SC BFA
FC Birlik
FC Blue Birds
US Bottecchia (anfangs Sportplatz Gartenstadt Münchenstein/ 'Bottecchia-Matte' „welche mit der Tramlinie 11 bequem zu erreichen ist“ und dann Dreispitz; später Rheinacker)
FC Breite (untere Mannschaften, erste Mannschaft siehe oben unter Stadion Landhof)
RCD Celta
FC Concordia (untere Mannschaften)
FC Eintracht
SC Eisenbahner (vorher Sportplatz der der St. Jakobskirche; später Bäumlihof)
CD Español (später Bachgraben)
FC Etoile Romande (FC Racing/E.R.)
FC Ferad
FFV Basel (auch Rankhof)
SC Flügelrad (FF60er-Flügelrad Sportplatz Fiechten Reinach)
FC Fortuna/Ballboys (3. Liga-Team)
SC Galatasaray Basel
FC Grischuna (später Bachgraben)
FC Gundeldingen
FC Güney
SV Helvetik (bis 1941 Sportplatz Dreispitz; ASC Helvetik Friedmatt; ASC Sparta-Helvetik Pfaffenholz und später Landauer)
SC Hungaria
FC Internazionale Basel (FC Internazionale-Milena Basel, auch Hörnli; später Bachgraben)
FC JTV (auch Bachgraben; später Schützenmatte)
FC Jugos (FK Beograd, vorher Hörnli)
FC Juventus Basilea (FC Juventus-Reggina)
FC Kon-Kurd
FC Lehenmatt
CD Lusitano
US Molisana
SC Morgarten (später Bachgraben, N.S.U. Morgarten)
US Napoli Basilea (später Pfaffenholz)
FC Polizei Basel (auch Bachgraben, vorher Schützenmatte)
FC Post (später Sportplatz IG PTT-Anlage/ Post Sportanlage Arlesheim)
FC Racing (FC Racing/E.R.)
VfR/ Verein für Rasenspiele (bis 1925 bei der Friedmatt, dann Sportplatz im Wasenboden hinter dem St. Johann-Bahnhof - trainiert wurde 1979-1987 auch beim FC Friedlingen in Deutschland - VfR Kleinhüningen Schorenmatte)
SC Regio Basel (ab 1986, vorher Unterwart Muttenz)
FC Schwarz-Weiss (später Bachgraben, früher Hiltalingerstrasse als FC Red Star)
FC Sloboda (später Rankhof)
FC Sportfreunde (später Bachgraben, Hörnli und Landauer; anfangs Sportplatz Reinacherhof Münchenstein)
FC Steinen (SC Steinen-Regio, SC Steinen; später auch Hörnli)
US Ticinese (vorher Clavelgut?, später Bachgraben)
AS Timau (vorher Landauer; später Bachgraben, erste Mannschaft Rückrunde 2003/04 Bäumlihof, Pfaffenholz und Rankhof)
FC Türkgücü (auch Bachgraben)
FC Ziegelhoppers
FC Basel Nachwuchs-Campus Hauptspielfeld mit gedeckter Zuschauertribüne 105 x 68 m (Platz 11)
Eröffnung am 17. August 2013 auf dem hinteren Teil der Sportanlagen St. Jakob mit einem zweistöckigen Gebäude (anstelle der nicht mehr zeitgemässen Garderoben G und H) und vier (sanierten) Plätzen sowie einem neuen Kunstrasenfeld (dessen Maximalkapazität aus Sicherheitsgründen 400 Zuschauer beträgt), welche inklusive einem Tennenplatz von der Stadt Basel an die den Campus tragende Stiftung abgetreten worden waren. Der zentrale Eingang wird durch eine Öffnung in der Grösse eines Fussballtors gebildet.
Am 10.1.2015 im Testspiel gegen den FC Hégenheim war der Campus mit 1'000 Besuchern ausverkauft, später wurde die Zulassung auf 500 beschränkt. Feld 7 ist aus Kunstrasen.
FC Basel
Sportzentrum Schützenmatte 1971
Die OB-Anlagen mit einem B- und C-Feld kamen mit Grossratsbeschluss für den Stadionumbau vom 15.1.1965 in den Besitz der Stadt. Mit Turnschuhen durfte für Trainings auch der gegenüberliegende Turnplatz benutzt werden, heisst es in einem Bericht anfangs der 80er Jahre. Auf die Saison 1991/92 konnte zusammen mit dem Sportamt und der Turnplatz-Kommission das Problem fehlender Trainingsmöglichkeiten insofern gelöst werden, dass neben den Plätzen vor Ort selbst (U21, Senioren und Veteranen) neu Möglichkeiten im Bachgraben (NLB), auf dem Landhof (3. Liga) und auf dem Turnplatz (Junioren) dazu kamen. Zudem wurde der Hauptplatz überholt (Trainage).
Das stark benutzte (damalige) B-Feld wurde 2002 komplett saniert.
BSC Old Boys (Platzclub)
FC Breite (andere Plätze siehe oben)
FC Polizei Basel (später St. Jakob oder Bachgraben)
Sportzentrum/ Campus Schützenmatte 2003 - 2005 (Ausbau und Sanierung des Bereichs des Turnplatzes)
Südliche Hälfte an der Neubadstrasse mit diversen Leichtathletikanlagen (Instandsetzung Aschenbahn u.a. Herbst 1961) und zwei Rasenfeldern, Garderobengebäuden (1933, 1946 und 12.6.1958: Kabinen im Parterre und in den Anbauten für die Vereine eigene Materialräume), Stehrampen (1955), einer gedeckten Tribüne (1935), permanenter Lautsprecheranlage (1961) und Beleuchtung (12.6.1958).
Als man den Old Boys 1921 die Schützenmatte anbot, war eine Bedingung, dass auch der Kantonalturnverband (KTV Basel-Stadt) Nutzungsrechte erhalten sollte. Besitz-Nachfolger der dafür gegründeten Turnplatz-Genossenschaft, welche den Unterhalt besorgte, wurde am 22.5.1951 die Turnplatzgesellschaft mit den Vereinen Bürger TV, JTV, TV Kaufleute, TV St. Johann und SC Rotweiss.
1993 wurde der Mietvertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst und die Anlage analog anderer staatlicher Sportanlagen vom Sportamt verwaltet und betrieben.
Weil es den Fussballern, von denen nur die Junioren ab und zu darauf trainieren durften, an Platz mangelte, wurden ab 2005 (offizielle Eröffnung 10.6.2006) im Rahmen einer besseren Aufteilung mit ganzjährig bespielbaren Sportflächen ein Rasenspielfeld und ein Kunstrasenfeld (25.10.2005 als damals grösstes der Region: „das neue Feld kommt nun den Eigenschaften von Naturrasen sehr nahe, da eine spezielle Füllung aus Kryogengummi und Quarzsand eine natürliche Rasentragschicht imitiert. Die zweifarbigen, leicht gerollten und dem natürlichen Rasen nachempfundenen Kunstrasenfasern entsprechen auch optisch weitgehend dem Naturrasen“ - Medienmittelung Erziehungsdepartement. Ersatz 2017) im Bereich der nicht mehr brauchbaren Aschenbahn neu erstellt (B und C, jeweils 100 x 64 m) sowie der bestehende Hartplatz für einen Kunststoffplatz von 40 x 20m verlegt. Ein neues Garderobengebäude als langer, einhüftig organisierter Baukörper mit auskragendem Vordach (Architekturbeschrieb) ersetzte die hölzernen Pavillons (u.a. aus Ratschlag Grosser Rat). Weil der BSC Old Boys, bei dem zwölf Einheiten auf dem Landhof trainierten, bereits damals ein Projekt für ein zweites Kunstrasenfeld lancierte, für das die Tennisplätze hätten verschoben und der Kunstrasen und die restlichen Felder quer eingezogen hätten werden sollen, wurde die Sanierung des B-Feldes und des Hartplatzes hinter der Turnhalle beim Polizeigebäude 2006 zurückgestellt.
Polizei Basel SC (Firmensport)
Sportanlagen Bachgraben (Gemeinde Allschwil)
Eröffnung 1979 mit drei Rasenspielfeldern als Ersatz für den zwischenzeitlichen Verlust von acht Spielfeldern auf den Sportanlagen St. Jakob (Ausstellung für Garten- und Landschaftsbau 'Grün 80') und als dringend benötigte Ergänzung zum ungenügenden Angebot im Raum Basel damals überhaupt mit viel Fronarbeit der 'Ur-Vereine' BCO, Eintracht Kispi, Grischuna, Morgarten, Schwarz-Weiss, Sportfreunde, SKA, Telegraph und Ticinese.
Am 27.4.1984 wurden drei zusätzliche Trainingsfelder ihrer Zweckbestimmung übergeben, die nach der Verlegung der Baumschule der Stadtgärtnerei nach Brüglingen auf zusätzlichen 25'000 Quadratmetern ebenfalls in freiwilliger Arbeit hergerichtet worden waren. Aus Kostengründen war auf eine Vergrösserung der Anlage mit vollwertigen Fussballplätzen verzichtet worden.
Der auch für die Leichtathletik gedachte, grosszügig angelegte Hauptplatz („sehr kleine Kabinen, schlechter Rasen, Abwart und Kioskbetreiber könnten bisschen höflicher sein, Fluglärm extrem...“ - Kommentar auf einer Internetbewertungsseite) ist 102 x 65 M gross und beleuchtet.
Daran schliessen Feld 3 (97 x 55 M), das an einer Längsseite für Zuschauer drei Stehstufen aufweist und (mit der Schmalseite in Richtung Dorfbach) Feld 1 (96 x 62,5 M) an.
Auf der anderen Seite ist der Allwetterplatz (Erneuerung 1992) aus der ersten Bauetappe („prekär ist es im Winter, wenn sich bei schlechten Platzverhältnissen und fehlender Beleuchtung der übrigen Spielfelder drei Mannschaften gleichzeitig im Dreischichten-Betrieb den einzigen Allwetterplatz zum Training teilen müssen“ - Stimme 1995) seit dem 13.11.2006 (Einweihung; weil das Wasser auf dem holprig gewordenen Trainingsfeld nicht mehr richtig ablief, verunmöglichten Pfützen oft genau dann eine Nutzung, wenn Platz nötig gewesen wäre - BaZ 1.6.2006) aus Kunstrasen (Feld 4: 95,6 x 62,8 M: „nach heutigen Erkenntnissen werden keine Sandplätze mehr gebaut, weil die Unterhaltskosten im Verhältnis zu den eingeschränkten Belegungszeiten zu hoch sind. Deshalb ist der Ersatz des Tenneplatzes durch ein Kunstrasenfeld einer Sanierung des Tennenplatzes vorzuziehen. Diese Lösung hat zwar höhere Erstellungskosten, der Platz kann aber ganzjährig bespielt werden. Tennenplätze finden bei den Sportlern in den Sommermonaten keine Akzeptanz mehr“ - Regierungsrat 2006. Sanierung Sommer 2017).
Daneben liegen aus dem Jahr 2015 Feld 6, das mittlerweile vom Basel Cricket Club genutzt wird und jeweils dahinter gegen die Promenade heute ebenfalls ohne Markierung Kleinspielflächen für den 9er- und 7er-Fussball.
FC Bachletten 2020
BCO (vorher St. Jakob; später auch Bäumlihof, BCO Alemannia Hörnli
FC Bosna (vorher Grendelmatte)
FC Breite (auch Sportanlagen St. Jakob)
FC Concordia (erste Mannschaft bis 1984)
CD Coruña (später Pfaffenholz)
FC Dardania Basel („wir sind eigentlich auf dem Bachgraben zu Hause, müssen aber manchmal auf die Sportanlagen St. Jakob ausweichen“ - 1997)
CD Español (vorher St. Jakob)
SC Genclik (auch Pfaffenholz)
FC Grischuna (vorher St. Jakob)
FC Internazionale Basilea (FC Internazionale-Milena Basilea, auch St. Jakob)
FC JTV (auch St. Jakob; später Schützenmatte)
FC Kispi (vorher Sportplatz PUK - FC Eintracht Kispi)
SC Kreditanstalt Basel (vorher St. Jakob - Firmensport)
AC Milan Club Basilea (später Rankhof)
SC Morgarten (vorher St. Jakob - N.S.U. Morgarten - Im Juni 1985 wurde von den Vereinen Morgarten und Telegraph für 3.- und 4.-Liga-Mannschaften sowie für Senioren erstmals ein Turnier um den sogenannten Bachgraben-Cup ausgetragen)
SC Natural (vorher St. Jakob - Firmensport)
BSC Old Boys (Umbau Schützenmatte 1985)
FC Polizei Basel (auch St. Jakob; vorher Schützenmatte)
FC Schwarz-Weiss (vorher St. Jakob und Clavelgut - FC Red Star)
FC Sportfreunde (vorher St. Jakob, später Hörnli; anfangs Sportplatz Reinacherhof in Münchenstein)
FC Telegraph
FC Thai (vorher Hörnli)
US Ticinese (vorher Clavelgut? und St. Jakob)
AS Timau (vorher Landauer, St. Jakob und Bäumlihof; später Pfaffenholz und Rankhof)
FC Türkgücü (auch St. Jakob)
Sportzentrum Pfaffenholz (Commune de Saint-Louis, France)
Spatenstich 26. Februar 1993. Einweihung am 2. September 1994 mit symbolischen Spielen der WWB gegen ein Auswahlteam und von Schweizer gegen französische Zöllner für das Miteinander von Behinderten und Nichtbehinderten sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die auf französischem Boden nordwestlich der Milchsuppe gelegene Anlage mit zwei Rasenfeldern und einem Allwetterplatz war der Ersatz für den Satus-Sportplatz Friedmatt, welcher der Nordtangente weichen musste. Sie war vom Basler Bürgerspital ermöglicht worden, welches das Land 1961 erworben hatte. Seit 2009 verfügt sie (inklusive eines Platzes für 7er-Fussball) über vier Rasenfelder, wovon das nach hinten verschobene Hauptfeld 105 x 68 Meter misst: dafür musste das eigentliche Hauptfeld mit damaliger 400m-Rundbahn nordöstlich der Dreifachturnhalle zugunsten des Tramausbaus der Linie 3 zum Bahnhof nach Saint-Louis verkleinert werden. Der Kunstrasenplatz entlang der Hangseite, der 2009 aus dem Allwetterplatz entstand, wurde 2020 saniert.
FC Alkar (vorher Landauer, NK Alkar)
ASC Sparta-Helvetik (später Landauer)
FC Brasil
FC Coruña (vorher Bachgraben)
FC Coruña-Napoli (US Napoli Basilea, vorher St. Jakob)
HNK Croatia Basel
FC Haskoc
FC New Stars (aus N.S.U. Morgarten - FFV Basel Rankhof und St. Jakob)
US Olympia
FC Taxi (SC Genclik, auch Bachgraben)
AS Timau (vorher Landauer, St. Jakob, Bachgraben und Bäumlihof; später Rankhof)
Auf dem Pfaffenholz haben auch viele Firmensportmannschaften ein neues Zuhause gefunden.
Sportplatz PUK Psychiatrische Universitätsklinik Basel
FC Kispi (später Bachgraben, wo die Heimspiele in der Regel ausgetragen wurden)
FC Young Stars
Der in den 60er Jahren entstandene Platz zwischen Oekonomiegebäude und Familiengarten-Areal, auf dem 1995 immerhin fünf Vereine zu Hause waren, wurde auch von Firmenmannschaften beansprucht. Seine Trainings- und Spielbedingungen wurden vom FC Young Stars, der auf die Anlage Pfaffenholz ausweichen konnte, Ende der 90er Jahre als nicht ideal bezeichnet. Ab 29.6.2006 neu als multifunktionaler Sportplatz.
Sportplatz Buschweilerhof Spielfeld 105 x 68 m
Buschwylerhof am Blotzheimerweg/ Lindenstrasse (Eingang Blotzheimerweg mit einem zweiten Eingang Tramhaltestelle Depot Neu-Allschwil), 19. August 1928 bis 1956. Er war nach seinem danebenliegenden Bauerngut benannt. Clubhaus-Einweihung 19.9.1953.
FC Black Stars
Ballspielclub (später St. Jakob und Dreispitz - Fusion mit SC Olympia)
Durch die Erstellung der Nidwaldnerstrasse, wo eine Wohnkolonie entstand, musste das vom Fussballclub gemietete, sich im Grundeigentum der Stadt befindliche Terrain verschoben und nahezu quer zum vorherigen Feld auf das alte Gut Buschwylerhof, das abgebaut worden war, gelegt, bzw. gedreht werden. Übergabe durch Regierungsrat Max Wullschleger vor rund 2'000 Anwesenden mit einem Turnier (FC Black Stars, FC Nordstern, FC Concordia, BSC Old Boys) am 26./27. Juli 1958. Für den Unterhalt und die Pflege des Areals im Baurecht musste der Verein selber aufkommen.
„Der Platz von 67 x 102 M ist mit einer soliden Brustwehr aus Beton und Eisenrohren umsäumt, um die herum für die Zuschauer ein Schlackenstreifen geschaffen wurde und weist auf der südlichen Seite hinter dem Tor eine Stehrampe und ausserhalb der Umzäunung ein kleines Trainingsfeld auf“ (Basler Nachrichten)
Bis zu seinem Tod (1963) widmete sich nach seiner Pensionierung Gründungsmitglied Franz Schumann der Betreuung der Platzanlage.
9.5.1961 Einweihung Beleuchtung halbes Spielfeld, 'damit der Trainingsbetrieb auch zu früher nächtlicher Stunde aufrechterhalten werden kann'.
1965 wurde in Fronarbeit für Nachtspiele jetzt auf dem ganzen Platz auf vier Holzmasten in achtzehn Meter Höhe eine Tiefstrahleranlage und mit Einweihung am 8. Oktober das 1971 renovierte Clubheim erstellt, das dasjenige von 1953 ablöste.
Für die Mannschaften stand neben dem 1968 oder 1987 sanierten Hauptfeld nur ein Trainingsdreieck („mal ein Sumpf, mal hart wie Beton“) zur Verfügung („wir zahlen lieber pro Jahr 40'000 Franken selber und bleiben dafür unabhängig“ - Zitat des Präsidenten 1994), weshalb man ab der Saison 2000/01 wegen der gestiegenen Juniorenzahlen für das Training und einige Meisterschaftsspiele (vorher bereits Sportplatz PUK) auch auf die Sportanlagen Bachgraben und den Rasen beim Wasgenringschulhaus (D- und E-Junioren) auswich ('was nicht im Sinne eines Quartiervereins mit eigener Clubbeiz sein kann' - Zitat).
24.2.1995 Einweihungsfest sanierte Douchenanlage 'nach Jahren des Flickens'.
Mit der Genehmigung einer neuen Nutzungsvereinbarung anstelle des bestehenden Baurechts- und Pachtvertrags zwischen dem Kanton und dem FC Black Stars Basel im Sommer 2003 fielen das Garderobengebäude und das Clubhaus an den Kanton heim, worauf eine Totalsanierung des Garderobengebäudes und Instandsetzung des Clubhauses folgten. Das Hauptfeld wurde neu angesät und auf dem (vorher 'völlig werwahrlosten') Trainingsfeld ein Kunstrasen eingelegt: alle Mannschaften liessen sich für ein halbes Jahr ausquartieren (Medienmitteilung Bau- und Verkehrsdepartement). Eröffnung 27.7.2004.
Kunstrasen Hauptfeld 21.5.2013 (Ersatz 2022), neues Garderobengebäude 28.7.2013:
„Wir bezahlen einen hohen Mietbetrag an die Stadt als Eigentümerin der Anlage. Sie ist nicht gerade luxuriös: ein einziges Spielfeld für 21 Mannschaften. Wir sind der einzige Club in der dritthöchsten Schweizer Spielklasse ohne Tribüne. Wir liessen zwei Container aufstellen, für den Speaker und für dringend benötigte Büroräume. Prompt kam die Stadt: Wir bräuchten einen Energienachweis. Die Denkmalpflege sagte, Container würden nicht ins Quartier passen. Oder die Cars: Die Gästeteams müssen die Spieler in einer Seitenstrasse aussteigen lassen“ (Black Stars-Chef Peter Faè in der bz Basel, 15.9.2019)
Zwischen Buschweilerweg und Nidwaldnerstrasse kamen nach der Verlegung des Fussballfeldes auch die (offene, 1995 überdachte) Rollschubahn (1960) und die Anlage für den Tennisclub Rheinbrücke (8.4.1961) zu liegen.
SPORTANLAGEN, FUSSBALLPLÄTZE KLEINBASEL
Sportzentrum Rankhof/Satusgrund
Spatenstich 5. Juli 1993, offizielle Eröffnung 17. August 1996 als Zusammenlegung und Neubau der vorher autonomen Sportplatzgenossenschaften Rankhof und Satusgrund, welche mit finanzellen und organisatorischen Schwierigkeiten gekämpft hatten („verstauchte Füsse auf den maroden Plätzen werden beim Schüler- und Lehrlingsturnen bald der Vergangenheit angehören“ - Plenum Grosser Rat), mit insgesamt sieben Naturrasenfeldern, einem Kunstrasenfeld, einem Allwetterplatz, einer Leichtathletik-Kombianlage sowie vier Tennisplätzen.
Der vordere Teil im Gebiet Rankhof konnte ab Anfang 1995 benutzt werden. Das Fussballfeld in der Kurve in Richtung Grenzacherstrasse (Feld 2 mit einer kleinen, baumbewachsenen Böschung - 90 x 58 m) und das Kunstrasenfeld (91 x 55 m) auf der Rückseite der neuen Tribüne, das neben den Damen- und Herrenteams des Basler Hockeyclub auch für Fussball vorgesehen war (wie aus Meldungen über Freundschaftsspiele z.B. vom Januar und Februar 2001 hervorgeht und obwohl dafür eigentlich nicht geeignet es heute noch bei schlechtem Wetter für das Training benutzt wird), wurden zuerst in Betrieb genommen. Nach den Sommerferien waren auch der Hauptplatz, ein weiteres Feld bei der Rankstrasse (Feld 3 am Bahndamm, 100 x 64 m) sowie ein Kleinfeld für den Schulsport bespielbar Der zweite Abschnitt auf dem ehemaligen Satusgrund mit vier Plätzen (jeweils 90 x 58 m) ging 1996 in Betrieb. Fussballerisch wurde die Anlage mit einem Freundschaftsspiel einer Basler Regionalauswahl gegen das B-Team aus Bahrein und dem Rankhof-Derby SC Baudepartement - FC Nordstern als Start der 2. Liga-Saison 1996/97 würdig eingeweiht.
Dem langersehnten und 2020 vom Grossen Rat beschlossenen Einbau eines Kunstrasens auf Feld 3 stand die Schutzbedürftigkeit einer Schwarzpappel entgegen. Dazu Christian Mensch in der bz Basel vom 17.6.2024: „der mächtige Baum ist unter Amateurfussballern eine Berühmtheit: Für linke Flügelstürmer ist er ein Ärgernis, weil heruntergefallene Äste häufig genug Flankenschüsse behindern. Für rechte Verteidiger ist er ein Segen, weil er den einzigen Schatten auf dem Feld bietet. Für manche andere Spieler bietet er zudem einen Ort der Entlastung, weil die nächstgelegene Toilette nicht in nützlicher Frist zu erreichen ist“. Als neuer Standort ist das Stadion vorgesehen, das im gleichen Zug mit der Vergrösserung des Spielfeldes um jeweils drei Meter sicherheitstechnisch auf den neusten Stand gebracht werden soll.
2025 Neuansaat von drei Trainingsplätzen: diese waren zur Bekämpfung des Japankäfers 2024 nicht mehr bewässert worden und kaputtgegangen.
FC Afghan (Inter Basel)
FC Afyon
SC Basel Nord (vorher Satusgrund und Hörnli)
ASV Basel-Ost
FF Brüglingen (später Rheinacker)
FC BVB (SV Verkehrsbetriebe NWS, FC Basler V.Betriebe; später Rheinacker)
SC Baudepartement
FFV Basel (auch St. Jakob)
Inter Basel
ASS Irpinia
AC Milan Club Basilea (vorher Bachgraben)
FC Nordstern (siehe oben)
SV Rapid (AS Rapid-Randazzo)
FC Sloboda (vorher St. Jakob)
FK Srbija
AS Timau (vorher Landauer, St. Jakob, Bachgraben, Bäumlihof und Pfaffenholz)
SV Transmontanos
FC Xalko
Sportplatz Schorenmatte
Eröffnung am 1. Dezember 1940 mit einem Übungs- und Spielfeld auf einem Areal, das bis dahin dem Baudepartement für Humus- und Steinablagerungen gedient hatte. Offizielle Einweihung am 20. Juli und 27. Juli 1941 (genutzt durch den SC Kleinhüningen, Turnverein Kleinhüningen und die Schulen des Einzugsgebietes). Ausbau Stehplätze auf Saison 1943/44.
Zuschauerrekord: 30.1.1944 SC Kleinhüningen - AC Bellinzona - 1. Liga ca. 2'500 („viele der Kiebitze vermochten [mangels Stehrampe] nur ab und zu einen Fetzen vom Spielgeschehen zu erhaschen - sofern sie es nicht vorzogen, gleich anderen auf den zur Zeit brachliegenden Eisenbahndamm zu klettern“ - NZ)
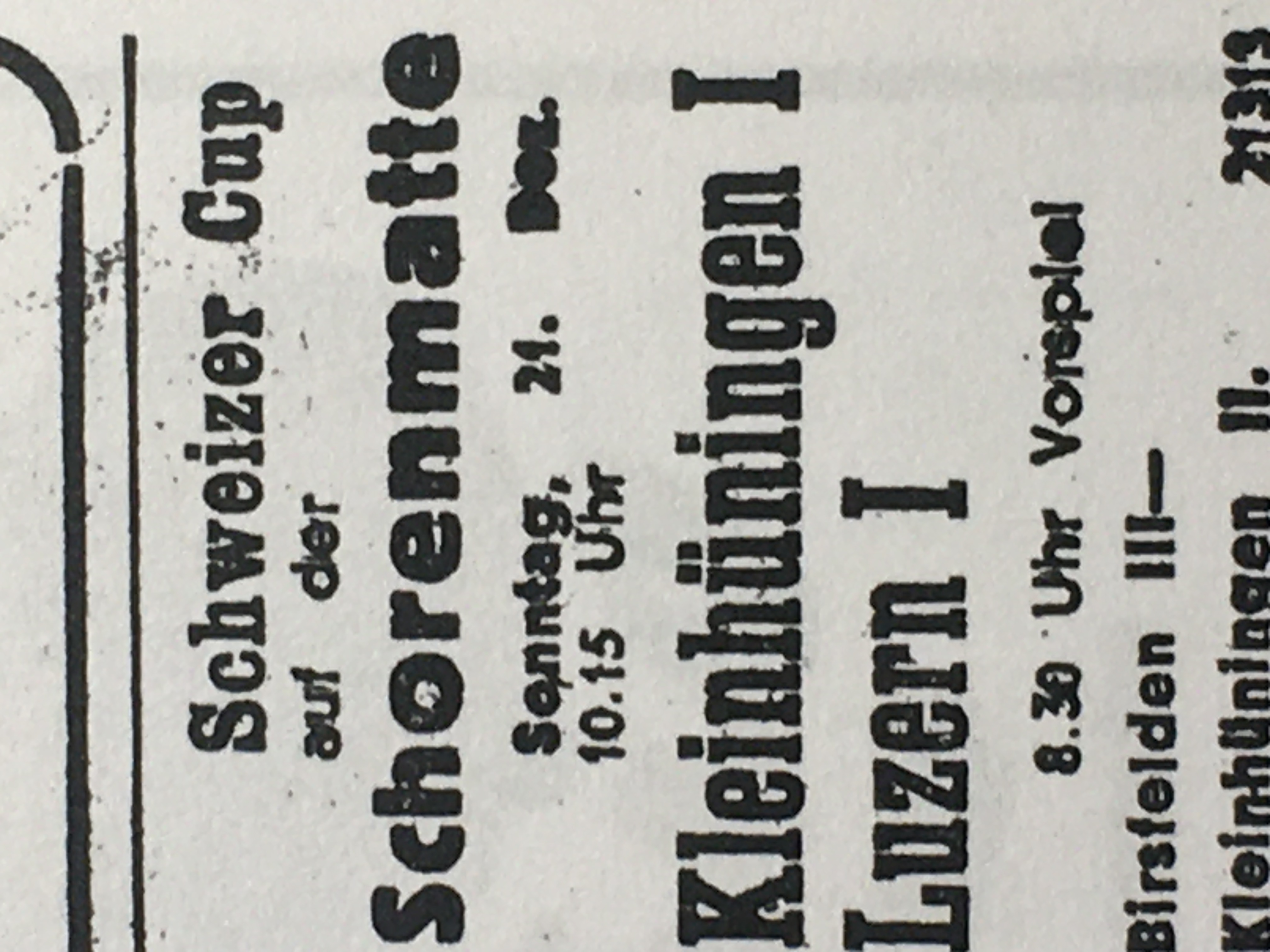
Am 2. August 1952 wurde der zum grossen Teil in Eigenregie umgestaltete, in Länge und Breite um jeweils drei Meter vergrösserte Platz (94½ x 54½ m) am Rande der Langen Erlen mit zementierten Stehrampen und einem Douchen- und zweiten Ankleideraum nach zweijähriger Bauzeit mit einem Freundschaftsspiel gegen den FC Basel wiedereröffnet ('als Garderobe diente eine Bretterhütte', hiess es dazu einmal wenig schmeichelhaft später). Einweihung Clubhaus am 20. März 1960:
„Sie sind endgültig vorbei. Die Zeiten nämlich, als die Kiebitze den heissen Kaffee in der Thermosflasche und die Nussgipfel im Hosensack auf die Schorenmatte schleppen mussten und die Fanatiker ihren während eines Spieles angesammelten Ärger nirgendwo im weiten Umkreis hinunterzuspülen Gelegenheit hatten“ - NZ
„Die Schorenmatte präsentierte sich am Samstagnachmittag ihren Besuchern als kleines Bijou. Nicht nur erstrahlte der Rasen in sattem, bis zu den Torlinien reichendem Grün, auch die ganze Umgebung mit Kassenhäuschen, Umkleidekabine und neuerbauter Schiedsrichterkabine war von Idealistenhänden in unzähligen Freizeitstunden 'verzaubert' worden“ (NZ 10.8.1959, Freundschaftsspiel SC Kleinhüningen - FC Basel 1:6)
„Obwohl die Sonne am Samstagnachmittag vom Himmel blickte, mussten wir uns doch den dicken Shawl um den Hals schlingen und trotzdem liess die beissende Kälte unsere Nase in Tropfen geraten. Auf der Schorenmatte war das Terrain steinhart gefroren und einige vereiste Stellen mussten vor dem Spiel zertreten werden, damit sie nicht im Verlaufe der Partie zu eigentlichen Eisbahnen wurden“ (als in Basel noch General Winter herrschte [III], und in der kalten Jahreszeit bei Minusgraden und auf gefrorenen Böden noch Fussball praktiziert wurde: 2. Liga-Spielbericht SC Kleinhüningen - SC Binningen 1:1, NZ 26.11.1962)
„Das Cluborgan hält [1970] fest, es sei immer das Ziel gewesen, «ein Zentrum und Treffpunkt für unsere Mitglieder auf unserem Sportplatz zu schaffen, wo man sich auch vor und nach den Wettspielen in befreundetem Kreise aufhalten und den Gedankenaustausch pflegen konnte»“ (zitiert bei Fabiano De Pasquale)
Erstellung von zwei 18 Meter hohen Beleuchtungsmasten für Trainingszwecke und kleinere Spiele im Dezember 1964.
„Es ist das Schicksal des kleinen Sportplatzes Schorenmatte, dass er allen Witterungsunbillen ausgesetzt ist. Bei starken Regenfällen dauert es dreimal länger als bei anderen Plätzen, bis das Terrain wieder einigermassen spielbar ist. Kommt dann eine Kältewelle, ist der Boden pickelhart gefroren“ (BN 18.12.1972)
Eröffnung der neuen Schorenmatte am 8. November 1975 „als erhebliche finanzielle Belastung für den Verein trotz behördlicher Subvention“ mit umgebautem Aufenthaltsraum, 'der zum Mittelpunkt des Vereins wurde und nun auch für Anlässe genutzt werden konnte. So fand die Generalversammlung fortan regelmässig auf der Schorenmatte und nicht mehr im Restaurant Schiff in Kleinhüningen statt' (Zitat Fabiano De Pasquale). Gegen die Beleuchtung des Trainingsfeldes erhob das Wasserwerk erfolgreich Einsprache.
Auf dem engen Platz kam eine gradlinige Spielweise am besten zum Zug, auf Strafraumhöhe konnte auch ein Einwurf für Gefahr sorgen:
„Die Schorenmatte ist berüchtigt - die kleinen Spielfeldmasse und ein unbeschreiblich katastrophaler Boden hinderten die Akteure daran, ein normales Fussballspiel aufzuziehen. Einsatz, Kampf und Engagement waren gefragt, für subtile Techniker gab es weder Platz noch Zeit, um ein eventuelles Kombinationsspiel in Gang zu bringen“ (Basler Cup Achtelfinal SC Kleinhüningen - FC Arlesheim, Basellandschaftliche Zeitung 19.9.1994)
Eröffnung Neubau nach Sanierung am 5. September 1985 mit einem lange verhinderten, 90 x 47 m grossen Allwetter-Tennenplatz mit Trainingsbeleuchtung, der schräg auf die Spielwiese gegenüber zu liegen kam, nachdem sich das Vereinsleben trotz dem Treffpunktcharakter des ebenfalls aufgehübschten 'Schoren-Beizli' mehr und mehr eingeschränkt hatte. Insbesondere die Jugend liess sich nicht mehr dazu bewegen, auf der Anlage, die ab 1983 von der Stadt an den Club in Eigenverantwortung untervermietet war und sich in einem schlechten Zustand befand, Sport zu treiben. Trotz des frischen Rasens, neuer Kabinen und jetzt gedeckten Ersatzspielerbänken blieben die Bedingungen für über zehn Mannschaften prekär („die Duschen, wenn sie gerade warmes Wasser liefern, sollten unter Denkmalschutz gestellt werden“ - Kommentar auf einer Internet-Bewertungsseite)
Ab Sommer 2007 standen auf der 'Exerzierwiese' beim Pumpwerk für die Jugendmannschaften und Schulen zwei neue Trainingsfelder zur Verfügung.
Eröffnung Neubau Garderobengebäude mit Clublokal März 2021. Mit Verlegung der Strasse entstand als neues Sportfeld Ost mit Berechtigung für die 2. Liga statt dem Tennenplatz und der Exerzierwiese ein modernes Terrain. Die Abmessungen des sanierten West-Feldes entlang des Schorenweges hatten den Normen des Verbandes schon lange nicht mehr entsprochen und Meisterschaftsspiele konnten nur mit einer Sondergenehmigung ausgetragen werden. Speziell war auch, dass Baumkronen der an der einen Längsseite vorhandenen Allee und die ausgewachsenen Bäume an den beiden Stirnseiten teilweise ins Feld hineinragten.
Im Januar 2025 forderte eine Motion bürgerlicher Politiker weitere Verbesserungen. Die beiden Naturrasen-Felder Ost (Spielbetrieb, 11er-Fussball) und West (welches vor allem dem Training der Jugendmannschaften dient) seien ungenügend beleuchtet. Die Nutzung während dem Winter sei eingeschränkt und Sperrungen eher die Regel als die Ausnahme. Wegen der fehlenden Möglichkeiten müssten die Juniorenteams oft kurzfristig auf weiter entfernte Anlage ausweichen (Eltern müssten ihre Kinder durch die ganze Stadt zum Training fahren und auch das Material müsse ständig von der Schorenmatte auf andere Plätze und wieder zurückgebracht werden - Prime News 4.2.2025) oder mit Lauftrainings vorliebnehmen. Die Probleme auch der Überbelastung könnten nur mittels einem Kunstrasen gelöst werden.
SC Kleinhüningen (VfR Kleinhüningen)
1.9.1923 bis 1929 Sportplatz an der Neuhausstrasse bis zum Bau der Gasfabrik. Zwischenzeitlich bis zu seiner Vergrösserung nach Aufnahme in den SFAV auf dem Terrain des FC Riehen an der Wiese. 1930 bis 1936 Sportplatz an der Hiltalingerstrasse hinter dem Clavel'schen Gut nach einem am 1. Mai 1929 abgeschlossenen Vertrag mit dem Erziehungsdepartement, der am 1. November 1936 wegen dem Bau des Hafenbeckens II gekündigt wurde. Bis zur Einweihung der Schorenmatte auf den Sportanlagen St. Jakob.
Sportplatz Hörnli/ Sportplatz am Bettingerweg Spielfeld 100 x 64 m
Das inmitten einer grossen Anzahl von Familiengärten zwischen Bettingerweg und dem Bahndamm gelegene Terrain von 22'595 Quadratmetern Fläche wurde inklusive Lauf- (400 Meter-Aschenbahn) und Sprunganlagen für die Leichtathletik in mehreren Etappen bis 1939 in Fronarbeit fertiggestellt. Der Sportplatz der katholischen, 'schwarzen' Vereine hat seinen Namen aufgrund seiner Nähe zum Basler Zentralfriedhof, bzw. zum Grenzacher Horn erhalten.
Während des zweiten Weltkriegs wurde er als Kartoffelacker genutzt und am 19. August 1950 sowie am 29. August 1959 mit einem neuen Sportplatzgebäude (als Massiv-Haus mit einem Aufenthaltsraum im Parterre und im ersten Stock der Abwartswohnung neben dem Garderobenneubau in einfacher Holzkonstruktion) anlässlich des 50jährigen Bestehens des Verbandes wiedereröffnet. Als Garderobengebäude hatte ab 1933 zuerst eine ehemalige Militärbaracke gedient, die 1950 durch die Erstellung eines neuen Traktes entlastet worden war.
Die Leichtathletikanlage wurde 1965 erneuert und 1995 entfernt. Letzte Sanierung der auch von Schulen und Turnvereinen genutzten Anlage, die ihr Cachet behalten durfte, 2002 (Neubau Garderoben).
Zum Sportplatz Landauer hin und mittlerweile auch auf der Seite hinter dem anderen Tor bestehen kleine Trainingsfelder und seit 1991 sogar etwas Licht, währenddem der eigentliche Platz als einer der letzten der Region lange unbeleuchtet war: am 9.11.2020 wurden neun Flutlichtmasten montiert, welche am 19.11. („nach jahrelangem Sport im Halbdunkeln“) zum ersten Mal in Betrieb genommen werden konnten.
Grundlage: Pachtverträge zwischen dem Gas- und Wasserwerk Basel und dem Katholischen Turn- und Sportverband beider Basel KTSVB vom 4. März 1931, bzw. 25. November 1948 (Rechtsform neu als Sportplatzgenossenschaft Hörnli). Ursprünglich waren die dem KTVSB angeschlossenen Vereine und der Verband selbst die Trägerschaft, bis später eine eigentliche Platzgenossenschaft gegründet wurde, die sich weitgehend aus Mitgliedern der Turnvereine St. Johann und St. Clara und der Fussballclubs St. Clara und Alemannia zusammensetzte.
„Seit dem Heimfall und Auslaufen des nicht verlängerten Pachtvertrages am 27.9.2020 obliegt die Verwaltung und Pflege des Sportplatzes sowie der Betrieb der Kantine dem Sportamt Basel-Stadt“ (Webseite des Sportplatzes Hörnli)
FC Alemannia (BCO Alemannia, auch Bäumlihof; vorher Sportplatz Lange Erlen und als Untermieter des FC Birsfelden)
FC Atletico Leones
SC Basel Nord (vorher Satusgrund; später Rankhof)
FC Bosna
FC Breite (90er Jahre)
SC Feuerwache
FC Internazionale Basilea (2. Liga)
FC Jugos (später St. Jakob - FK Beograd)
FC Rot-Schwarz (auch Friedmatt)
FC Sportfreunde (vorher Bachgraben und St. Jakob, anfangs Sportplatz Reinacherhof Münchenstein; später Landauer)
FC St. Clara (FC Breite-St. Clara und SC Steinen/Breite-St. Clara, Juniorenteams St. Jakob)
FC Thai (später Bachgraben)
FC Tetova
Sportanlage/ Sportplatz Rheinacker Spielfeld 90 x 54 m (bis 2013 und Übergabe an das Sportamt Basel-Stadt als Novartis-Firmensportanlage Landauer: per 1.1.2025 Übernahme durch den Kanton)
Der kleine Platz schmiegt sich wie seine Nachbarn Landauer und Hörnli an das Trassee der Wiesentalbahn. Wer die Fussballidylle der unteren Ligen vermisst, wird hier am östlichen Stadtrand noch fündig.
FC Basler V.Betriebe (vorher Rankhof)
SC Basler Versicherungen (vorher St. Jakob - Firmensport)
US Bottecchia (vorher St. Jakob)
FF Brüglingen (vorher Rankhof)
SC IWB (vorher Rankhof - Firmensport)
FC UBS (vorher Landauer - Firmensport)
Sportplatz Grendelmatte 23.6.1929
Das ca. 33'000 Quadratmeter umfassende Areal war von Kirschbäumen umgeben und gegen Eindringlinge von drei Seiten durch einen hohen Pallisadenhag geschützt, während westwärts ein alter Teich eine natürliche Abgrenzung bildete. Angelehnt an die Aschenbahn, die eine Länge von 400 Meter und eine Breite von 5 Meter hatte, war der Trainingsplatz der Fussballer und Leichtathleten, welche über Umkleide-, Materialräume und eine Toilettenanlage verfügen konnten. An der Eröffnung in der damals 6'600 Einwohner zählenden Gemeinde beteiligten sich neben dem FC Riehen die Sportvereinigung Riehen (Athletenclub für Kraftsport), der Turnverein Riehen sowie die Turnsektion Audacia des Katholischen Jüngling- (und späteren katholischen Turn-)vereins Riehen. Ein provisorisches Rasenfeld hatte ab Dezember 1928 bestanden (Quelle Rolf Spriessler)
Die Einweihung des neuerstellten Spielfeldes für Fussball und Handball am 14.8.1938, das von den Gemeindebehörden mit einem Kostenaufwand von 9000 Franken ermöglicht worden war, fiel dem schlechten Wetter zum Opfer.
Stadion Grendelmatte 14.8.1955 Spielfeld 100 x 64 m
In den 50er- Jahren wurde der Sportplatz von Grund auf neu gestaltet. Die zwei Terrains aufweisende, 40'000 Quadratmeter umfassende Anlage wurde längs zur Grendelgasse gedreht und mit einer ca. 450 Personen Platz bietenden Betontribüne mit Garderoberäumen, 400 Meter-Aschenbahn und Sprung- und Wurfanlagen nach zwei Jahren Bauzeit eröffnet:
„Der Rasen der beiden Spielplätze präsentierte sich mit seinem satten Grün auf dem einzigartigen Stadion der Gemeinde Riehens“ (NZ 20.8.1962). Das kleine (Trainings-)Feld entsprach für Ernstkämpfe jedenfalls des Satus mit dem FC Amicitia Riehen knapp den Minimalmassen.
13.6.1972: Wiedereröffnung Hauptfeld, das neu von einer Tartanbahn umgeben war, mit Drainage und Flutlicht. Die gut präparierte Anlage besass einen ausgezeichneten Ruf. C-Feld (70 x 45 m) jenseits des neuen Teiches. Hartplatz.
18.10.1991: zwischen Haupteingang und Festzelt Einweihung neues Garderobengebäude mit Kraftraum, Aufenthaltsraum und Grossküche, nachdem zwischenzeitlich als Provisorium Container hatten aufgestellt werden müssen, sowie Zeitmessturm für die Leichtathletik. Elektronische Anzeigetafel 1992.
Die Sportanlage mit vier Rasenfeldern galt für die 35 Fussballteams des FC Riehen und FC Amicitia Riehen 1997 als 'hoffnungslos überlastet' (1997 Projekt mit zwei Fussballfeldern im Gebiet Zwischen Teichen. 1999 Projekt für ein zweites Fussballfeld Im Bändli); das B-Feld (90 x 57 m), welches ab Juli 1999 saniert wurde und neu nicht mehr nur als Trainings-, sondern auch als Wettspielfeld benutzbar war, als uneben.
Wiedereröffnung sanierte Leichtathletikanlage 6.9.2002: dank Beleuchtungsmasten mit einer Lichtstärke von 200 Lux war das Stadion neu bis Nationalliga B tauglich.
Kunstrasenfeld für Kinderfussball, das anstelle des Fitnessplatzes und des halben Kunststoffhartplatzes errichtet wurde (65 x 44 m), Juni 2006 (Sommer 2007 bis Mai 2008 vorübergehende Schliessung wegen Mängeln bei der Entwässerung. Ersatz 2017). Sanierung Hauptspielfeld 2020.
Zuschauerrekord: 21.10.1956 FC Riehen vs. Grasshopper Club Zürich - Schweizer Cup 1/32 Finals ca. 2'500
FC Riehen (bis Oktober 1926 ausserhalb der Langen Erlen Spielplatz an der Wiese als Untermieter des Schäferhundevereins Riehen/ Basel auf einem Areal des ehemaligen Gaswerkes)
FC Amicitia Riehen
FC Bosna (später Bachgraben)
Sportplatz Bändli 1981 Spielfeld 100 x 64 Meter
Brühlweg als Filiale auf einem benachbarten Gelände jenseits der Grendelgasse (1972). Sanierung 2001/02 u.a. mit dem Einbau einer Drainage zur Entwässerung, nebst dem der Platz ebener und damit weniger unfallträchtig gemacht wurde.
Ein umfassendes Sportzentrums im Gebiet Grendelmatte liess sich politisch nicht realisieren.
Sportanlage/ Sportplatz Gymnasium Bäumlihof (Schulsportanlage Bäumlihof) Spielfeld 102 x 64 m
Inbetriebnahme 1976, bzw. 11.6.1977 (400 Meter-Kunststoffbahn) als damals nach St. Jakob zweitgrösstes polysportives Zentrum der Stadt inklusive mittlerweile zwei Kleinrasenfeldern (76 x 50 und 64 x 45 m) gegen die Bäumlihofstrasse. Die Bäumlihofanlage dient neben der Leichtathletik und (früher) dem Handball vor allem dem Schulsport.
BCO (auch Bachgraben, vorher St. Jakob - SC Olympia Sportplatz Dreispitz. BCO Alemannia auch Hörnli: im Winter ist man mangels Flutlicht weiterhin gezwungen, seine Junioren auf Ausweichorte zu verteilen)
SC Eisenbahner (vorher St. Jakob)
FC Gymnasium Bäumlihof
AS Timau (vorher Landauer, St. Jakob; später Pfaffenholz und Rankhof
HISTORISCHE FUSSBALLPLÄTZE GROSSBASEL
Auf der Schützenmatte („die sich hinter der alten Elsässerbahnlinie Steinenring-Spalenring vom Weiherweg bis zur Bachletten hinzog, und wo oft fünf bis sechs Matches zur gleichen Zeit ausgetragen wurden“ - Jubiläumschronik 30 Jahre FC Nordstern), der Türkheimermatte, dem Schellenmätteli an der Schanzenstrasse, dem St. Johannplatz, der Margarethenwiese, im Gundeldinger-Quartier oder auf der Breite standen den Schülern - nachdem die „verrückte englische Balltreterei“ auch in Basel Wurzeln fasste und an allen Enden der Stadt Vereine aus dem Boden schossen - die ersten Spielplätze zur Verfügung.
Auf dem Turnplatz unterhalb des Viadukts hatten sich im Sommer und in den Herbstferien 1893 regelmässig Mitglieder des Realschüler-Turnvereins getroffen und spielten unter der Anleitung von Adolf 'Papa' Glatz Fussball [der mehr und mehr in Vergessenheit geratene Turnplatz des Bürgerturnvereins an der Binningerstrasse am Rand des Nachtigallenwäldchens wurde 1960 zu einem Parkplatz]
Erster Weltkrieg, staatliche Beschlagnahmung von Spielplätzen für die landwirtschaftliche Produktion:
„In Basel blieben den Sportvereinen 1917 nur der Landhof und die Margarethenwiese erhalten. Die Nutzungskapazität bei einer Gesamtzahl von rund 1'300 Mitgliedern in sieben Fussballclubs und drei Athletikvereinen, die in der Saison 1917/18 in dreiundzwanzig Mannschaften 365 Wettspiele austrugen, war erreicht. Ein Initiativkomitee, dass alle Basler Vertreter sämtlicher Vereine und Verbände umfasste, die Leibesübungen betrieben, und dass von Grossrat Fritz Hauser präsidiert wurde, reichte bei den Baselstädtischen Behörden erfolglos eine Initiative zum Bau eines Zentralsportplatzes ein“ (Hans-Dieter Gerber)
Spielsituation 1929:
FC Alemannia Sportplatz Birsfelden (Untermieter), FC Basel Landhof im Kleinbasel, FC Black Stars Buschwylerhof, Ballspielclub Buschwylerhof (Untermieter), USI Bottecchia Basilea Gartenstadt in Münchenstein, FC Breite Sportplatz Birsfelden, FC Concordia Heiligholz in Münchenstein, SV Helvetik Dreispitz, SC Kleinhüningen Clavelgut in Kleinhüningen, FC JTV wohl Schützenmatte (Untermieter), BSC Old Boys Schützenmatte, SC Olympia Dreispitz, FC Nordstern Rankhof im Kleinbasel, Verein für Rasenspiele im Wasenboden im St. Johann, FC Riehen Grendelmatte, FC Sportfreunde Reinacherhof in Reinach, US Ticinese wohl Clavelgut im Kleinbasel (Unterrmieter). Arbeiterfussball Friedmatt im St. Johann, Clavelgut Kleinhüningen und Landauer im Kleinbasel
St. Johann:
Im Mai 1907 wurde dem 1903 noch einmal gegründeten FC St. Johann, dem schon 1898 die Wiese beim Entenweidgässlein verwehrt geblieben war, das Fussballspiel auf der Vogesenmatte durch polizeiliche Bekanntmachung verboten. Danach verhandelte er wie später der FC Nordstern mit dem ACV erfolglos für eine Bleibe auf dem Areal beim Lysbüchel. Das erste Sportfeld befand sich beim Gaswerk.
Ab 1907 gelangten Vereine, die ursprünglich in anderen Quartieren zuhause waren, ins St. Johann, denn vor allem im Gebiet Vogesenstrasse-Landskronstrasse bestand die Möglichkeit, von Privaten Land zu pachten. So zählte der an den Ecken Mülhauserstrasse und Ryffstrasse fündig gewordene FC Excelsior 1912 gegen 70 Mitglieder. Etwa an dieser Stelle gab auch der von Kleinhüningen ins St. Johann gewechselte FC Basilea sein Debut im Schweizerischen Verband. Auf die Saison 1913/14 wurde er durch die Black Stars, die offenbar ein besseres Angebot unterbreitet hatten, verdrängt, aber fand bis 1917 (Pflanzlandzwecke) an der Lichtstrasse zwischen Fabrikstrasse und Hüningerstrasse ein sogar noch geeigneteres Terrain.
Neuen Schwung brachte das St. Johann auch dem FC Grasshoppers. Er vermeldete 1908/1909 einen eigenen Platz an der Hüningerstrasse, nachdem er zuvor ebenfalls an der Landskronstrasse gespielt hatte:
„am Sonntag fand auf dem Grasshopper Sportsplatze ein Match statt zwischen Grasshopper Grossbasel I und Fussballclub Breite I: letztere siegten mit 1:7 Goals“ (BN 15.12.1908)
Anfangs der zwanziger Jahre schloss sich durch den zunächst (und wieder ab 1927) im Arbeiterfussball engagierten SC St. Johann, der seinen Namen aus Young Boys ändern musste, wieder der Kreis. Auf seinen Sportplatz Friedmatt gesellte sich der FC Sparta dazu, welche die Mannschaften des Quartieres ablösten.
Sportplatz im Wasenboden 1920 - 1936
Hinter dem St. Johann-Bahnhof, erreichbar über die Tramhaltestellen Kannenfeldplatz oder Landesgrenze Saint-Louis.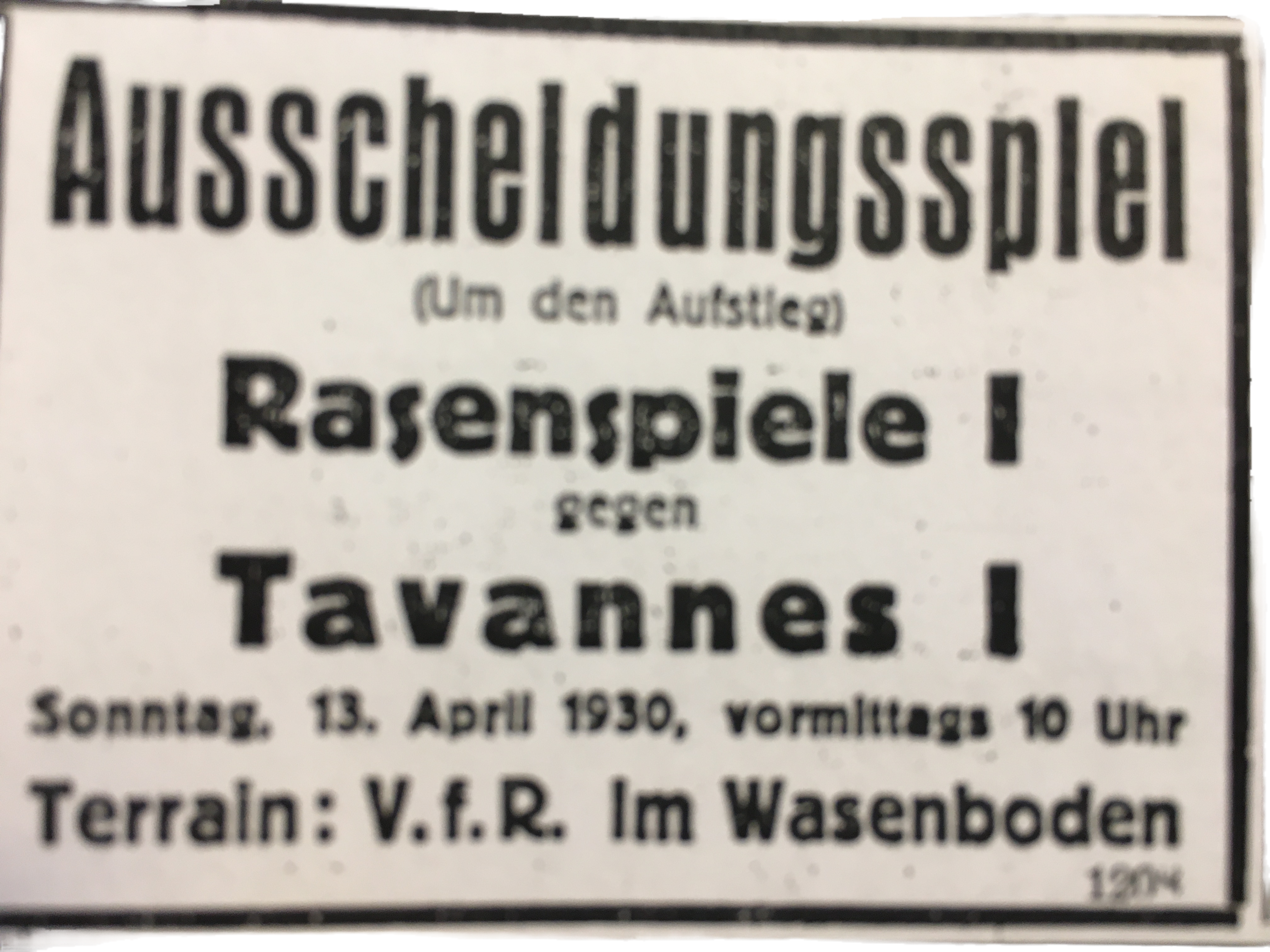
Verein für Rasenspiele/ FC Young Fellows (vorher beim Pumpwerk in den Langen Erlen)
Die Fussballvereine FC Young Boys St. Johann, FC Black Stars und VfR verhandelten im Herbst 1920 zur Mietung je eines grossen Sportplatzes über den zum Spitalgut der 'Milchsuppe' gehörenden Landkomplex, welcher sich wegen seiner mageren Erdbeschaffenheit wenig zur Anpflanzung eignete und öfters zum Hornussen benutzt worden war. Der aus Young Fellows Basel umbenannte Verein war eigentlich im Kleinbasel zu Hause. Mit dem eigenen Terrain wurde wie für den (ebenfalls unter neuem Namen firmierenden) SC St. Johann die Teilnahme an der Schweizerischen Meisterschaft möglich.
Bachletten, Gotthelf, Iselin:
Als dankbare Möglichkeit und als „eigentliches Tummelfeld der zahllosen Fussballjünger“ bot sich zunächst die im Frühjahr 1895 vom Militärdepartement als Spielplatz freigegebene Schützenmatte an (unterer Teil neben der alten, noch an Stelle des Spalen- und Steinenrings fahrenden Elsässerbahn - ab Spätherbst 1896 auch auf dem oberen Platze oberhalb der Belchenstrasse bis zum Kugelwall, das heisst ungefähr der jetzigen Brennerstrasse). Hier fanden die Old Boys, Britannia (Fusion mit OB 1899), Gymnasia (Fusion mit OB 1904), die Young Kickers und auch Fortuna (vorher Pauluskirchplatz) einen Ort, bis für die Beanspruchung einer Parkanlage im nördlichen Teil verschiedene Terrains aufgegeben werden mussten (Eugen A. Meier).
1922 eröffnete auf der Schützenmatte das Stadion (Old Boys).
Sportwiesen meist nur für kurze Zeit konnten genutzt werden am St. Galler-Ring (St. Gallerwiese - FC Südstern, FC Black Stars), zwischen Colmarer- und Rufacherstrasse (FC Liberia anfangs 1905), an der Türkheimerstrasse (Türkheimermatte bis 1906 wegen der Überbauung durch die Settelen AG - FC Fortuna 1899, FC Helvetia, FC Liberia, FC Young Kickers) oder an der Gotthelfstrasse (FC Helvetia, FC Liberia).
Beim Gotthelfschulhaus spielte in den 10er-Jahren erfolgreich der FC Breite.
FC Black Stars: Sportwiese an der Hegenheimerstrasse Ecke Strassburgerallee (1905 bis 1912), Spielplatz an der äusseren Hegenheimerstrasse (Eröffnung am 4. August 1912), Vogesenstrasse Ecke Mülhauserstrasse 1913/14 bis 1916 (Verzicht und kriegsbedingter Rückzug), Sportwiese an der Rixheimerstrasse (1919).
Sportplatz Neu-Allschwil (Ecke Schützenweg/Spitzwaldstrasse/ beim Tramdepot) 28. November 1920 bis 1928
(„Um recht vielen den Besuch dieses aussergewöhnlichen Spieles zu ermöglichen, ist dasselbe auf Sonntag vormittag punkt zehn Uhr anberaumt: Tramlinien 6 und 9 stellen eine gute Verbindung nach dem Black Stars-Areal her, sodass, in Verbindung mit dem frühzeitigen Beginn, wieder jedermann rechtzeitig zum Mittagstisch zurückfahren kann“ - Vorschau NZ 11.4.1926): auf dem ehemaligen Black Stars-Platz waren 1930 vier Dreifamilienhäuser mit Autoboxen rohbaufertig. Die vom Club erste genutzte Sportwiese befand sich an der Hegenheimerstrasse Ecke Strassburgerallee. Der Verein aus dem äusseren Spalenquartier verhandelte im Herbst 1920 um einen Platz an der Mittleren Strasse im St. Johann-Quartier, wo er ab der Saison 1913/14 vorübergehend ein neues Zuhause gefunden hatte.
FC Black Stars
Gundeli, St. Alban, Breite:
Erwähnt wird schon ab 1895 die Margarethenwiese.
Auf dem Spielplatz an der Thiersteinerallee trugen neben dem Hauptmieter FC Excelsior (vorher Schützenmatte) und dem FC Gymnasia (Fusion mit OB 1904) bis in den Herbst 1902 auch der FC Basel und der FC Old Boys Spiele aus, die ihre vorherigen Plätze verloren hatten. Das erste grosse Turnier führte 1901 sämtliche damals führenden Basler Vereine zusammen.
Die Sportwiese an der Laufenstrasse (Laufenmatte) diente noch 1906 als Heimstätte des FC Viktoria.
Auf dem Dreispitz waren der gleichnamige FC Excelsior (äussere Gundeldingerstrasse ab 1911) und der FC Concordia (1909 bis 1917 äussere Gundeldingerstrasse) zu Hause: sein erstes Terrain hatte sich an der Delsbergerallee/ Dornacherstrasse befunden.
Ab September 1920 (bis 1941 - 'Anbauschlacht Wahlen') beim Tramdepot zwischen Brüglingerweg und Münchensteinerstrasse von der Christoph Merian-Stiftung (Tramverbindung ab Aeschenplatz Linie 11 und Birseckbahn). Der Platz wurde nach dem Krieg nicht mehr erneuert und durch die 'Automobile Agence Américaine' überbaut.
SV Helvetik (Platzclub)
US Bottecchia (vorher Sportplatz Gartenstadt Münchenstein)
SC Olympia (vorher Sportplatz Friedmatt - Fusion mit Ballspielclub zu BCO)
Eisenbahner-Sportplatz Wolf
Eröffnung am 29.8.1937 („in unermüdlicher und harter Arbeit haben die Eisenbahner ihren Sportplatz selbst ausgebaut. Franken und Franken haben sie zusammengespart, um sich das Material beschaffen zu können. Aus dem Kies- und Schuttplatz schufen sie ein ideales Fussballterrain“). Der Sportplatz befand sich oberhalb der St. Jakobskapelle Ecke St. Jakobstrasse-Walkeweg.
Eisenbahner (nachher Sportanlagen St. Jakob und Bäumlihof)
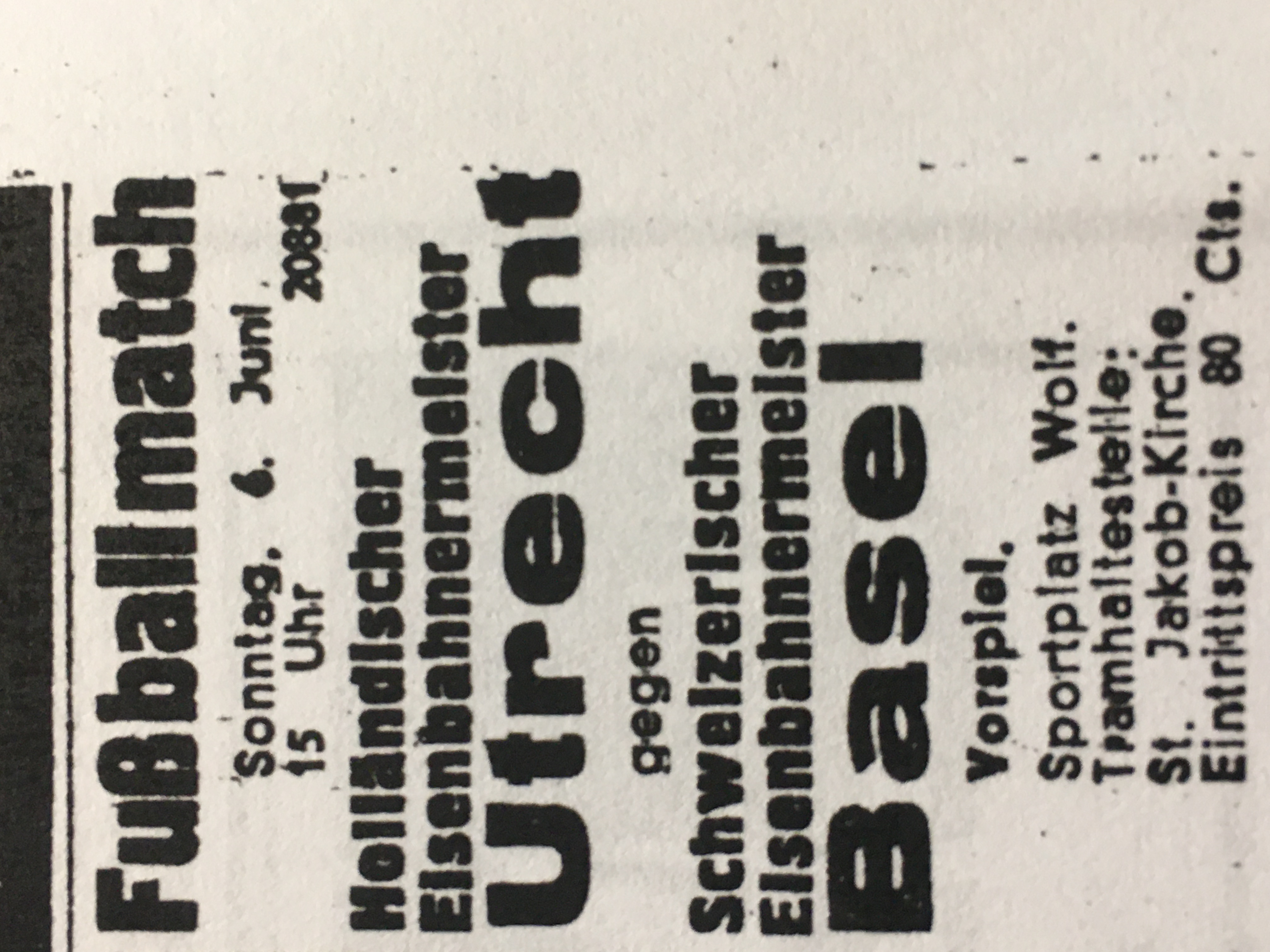
Sportplatz Luftmatt
Eröffnung am 21. August 1932 und offiziell am 2. Oktober 1932 (bis 1935) an der St. Jakobsstrasse als hinterer Teil der Luftmatt. Ab 1941 Kantonale Handelsschule.
FC Breite (andere Plätze siehe oben)
HISTORISCHE FUSSBALLPLÄTZE KLEINBASEL
Dem FC Basel wurde 1893 das Landhof-Areal zur Verfügung gestellt, wo 1897 im Innenraum der Radrennbahn ein Fussballfeld entstand (siehe oben). 'Hinter dem Landhof' ist 1907 auch ein Spiel zwischen den gerade gegründeten Fussballclubs von Rosenthal und Alemannia verortet.
Die Fischermatte hinter der alten Badischen Bahnlinie (FC Kleinbasel, FC Nordstern, FC Tasmania, FC Fortuna 1906), auf der sich die fussballbegeisterte Jugend Kleinbasels zu ersten Versuchen traf, musste den neuen Bauten der Badischen Bahn weichen.
Die Horburgmatte beim Rheinweilerweg (später Autosilo der Ciba Klybeck AG), wo neben Bolivia und Horburg von 1903 bis 1907 der FC Nordstern „sehr zu seinem Vorteil“ zu Hause war („verschiedene gute Spieler, die bis anhin bei Konkurrenzclubs mitgewirkt hatten, traten dem Club bei“ - Jubiläumschronik 50 Jahre), genügte den Anforderungen bald nicht mehr. Zudem wurde das Fussballspiel wohl untersagt („flogen Bälle ins benachbarte Areal oder auf den nahen Friedhof, mussten Strafgebühren bezahlt werden“, berichtet die Jubiläumsschrift des TV Horburg 1897)
Der an der äusseren Riehenstrasse diesseits der Tramhaltestelle Niederholz gelegene, mit einem Flächeninhalt von 25'000 Quadratmetern nach dem Landhof und der Margarethenwiese damals dritte grosse Basler Sportplatz, musste im Frühjahr 1917 an die Gemeinde Riehen zu Pflanzlandzwecken abgegeben und die A-Spiele daraufhin (bis zur Eröffnung des Rankhofs Ende 1923) auf dem Landhof, der Margarethenwiese und der Schützenmatte ausgetragen werden: für die unteren Serien diente das Trainingsfeld auf dem Bäumlihof.
FC Nordstern
Beginn auf der Fischermatte hinter der heutigen Erlenstrasse - etwa dort, wo 1912 das Silo-Gebäude der Basler Lagerhaus AG fertiggestellt wurde.
Horburgmatte ab Herbst 1903.
Egliseeholz November 1907 bis 1910 (untere Mannschaften auch Lange Erlen), 1911/12 (die Meriansche Matte an der äusseren Riehenstrasse wurde vom Gas- und Wasserwerk zur Verfügung gestellt. „Eine feste Einzäunung wurde nicht erlaubt, weshalb zu jedem Wettspiel eine Emballage-Wand auf stehende Holzpfosten gezogen und danach wieder abgetragen werden musste“ - Eugen A. Meier):
„Der Platz könnte entschieden besser, unmöglich schlechter gewesen sein. Allerdings trocken, doch kaum urbar gemachtes Terrain, auf dem noch nie gespielt worden war. Nordstern macht seinem Ruf alle Ehre. Die Combination ist tadellos, auch das Draufschlagen lässt nichts zu wünschen übrig. Das müssen nun denn die Badener auch nur zu schnell erfahren, indem kaum 10 Minuten nach Beginn der Fullback Hirzel einen Knieschlag erhält. Er fällt auf dem so viele Löcher auweisenden Boden, ein zweiter Schlag und der Mann ist zu dreiviertel kampfunfähig (...) Die berühmte Draufschlagerei der Sterne, die Versuche, die Besten der Gegner kampfunfähig zu setzen, sind vollständig gelungen. Es wäre jedoch sehr zu wünschen, dass sich die S.F.A. etwas näher um solche Terrains und Mannschaften kümmern würde, besonders da letztere den reinsten Rugbykampf veranstalteten. Auch kommen Sportsleute nicht a la Italiani auf den Platz, und müssen solche von der Referee ersucht werden, wenigstens während des Spiels die Brisagos entfernen zu wollen und sie in einen der bereitstehenden Maulwurfhalden zu stecken, damit sie nachher auch recht frisch seien“ (Serie B FC Nordstern vs. FC Baden 5:1 - Le Football Suisse 14.11.1907)
Sportwiese Lysbüchel 1910/11 (Bau ACV-Bäckerei):
„Es war auf dem Lysbüchel. Wir wussten nicht, wann uns die Polizei vom Platz jagte, denn wir hatten von der Verwaltung des A.C.V. keine Bewilligung erhalten. Concordia war der Gegner. Der Match hätte uns eventuell die Meisterschaft gekostet“ (Episode aus den B-Meisterschaftsspielen 1910 - Jubiläumschronik FC Nordstern 1921)
1917 bis 1920 Gastrecht auf der Margarethenwiese.
Frühjahr 1920 Terrain am Allmendweg.
Ab September 1921 hinter dem Bäumlihof als Pachtvertrag mit dem Gas- und Wasserwerk über ca. 13000 Quadratmeter („bis es uns 1920 endlich gelang, wenigstens für das Training und die unteren Wettspiele Landstücke zu pachten“ - Chronik '20 Jahre FC Nordstern', zwischen 1917 und 1920 wurde auf der Exerziermatte trainiert).
Auf die Saison 1928/29 wurde östlich anschliessend an den neuen Rankhof (ab 1923) anstelle des früheren Bäumlihofterrains ein (weiteres) Spielfeld errichtet.
Nachdem die Fischermatte und die Horburgmatte nicht mehr zur Verfügung standen, befanden sich die Sportwiesen für die neuen, wilden Vereine beim Pumpwerk in den Langen Erlen: die Blue Stars sollen links vom Schorenweg, Fortuna und Young Fellows rechts davon und Viktoria auf dem Gelände gegen die Riehenstrasse ihre Gegner empfangen haben (Eugen A. Meier). Die Bewilligung für den Exerzierplatz des Militärischen Vorunterrichtes hatte am 14. Mai 1905 als erster der FC Philadelphia erhalten.
„Drunten auf der Exerziermatte wurde nach allen Regeln der Kunst gewamst: zwei Baumgruppen an den Gestaden des Riehenteiches bildeten ein natürliches Goal“ (Jubiläumschronik FC Nordstern 20 Jahre): Trainingsplatz des FC Nordstern 1917 bis 1920.
Hier entwickelte sich auch der Arbeiterfussball (Augustinia/ ASC, FC Fortuna, FC Grasshoppers, FC Horburg, Vereinigte Sportfreunde), bis er 1924 auf seinen eigenen Platz an der Neuhausstrasse zog.
Ein Spielplatz im Surinam an der Riehenstrasse ist vom Polizeidepartement bereits 1900 erwähnt.
An der äusseren Riehenstrasse wurde dem FC Nordstern 1907 ein Platz beim Egliseeholz zugeteilt, auf dem er bis 1910 bleiben konnte (siehe oben).
Hauptmieter an der Ackerstrasse zwischen Tramdepot und dem Fluss Wiese war der FC Young Boys Kleinhüningen, wo bis 1908 auch der FC Basilea Kleinhüningen spielte: Die Young Boys fanden 1912 keine Aufnahme in die Schweizerische Football Association. Basilea zog ins St. Johann.
Sportplatz an der Hiltalingerstrasse (auf dem ehemaligen Clavelschen Gut)
29. Juni 1930 bis 1936 (Bau Hafenbecken II).
SC Kleinhüningen (vorher Sportplatz an der Neuhausstrasse, ab 1940 Schorenmatte - VfR Kleinhüningen)
FC Red Star (später St. Jakob als FC Schwarz-Weiss)
SPORTANLAGEN, FUSSBALLPLÄTZE ARBEITERFUSSBALL
(die zwischenzeitliche Abspaltung eines kommunistischen Verbandes Ende der 1920er Jahre erklärt den Bau der beiden voneinander getrennt verwalteteten Hauptanlagen Friedmatt und Satusgrund, die auf den ersten gemeinsamen Arbeitersportplatz an der Neuhausstrasse folgten. An den Satus, der sich ab Mitte der 60er Jahre nach und nach in den bürgerlichen Fussball integrierte, erinnert heute noch der verbliebene Landauer)
Sportplatz an der Neuhausstrasse
1923 bis am 30. Dezember 1928 (Bau Gasfabrik Neuhausstrasse 65; Beschluss des Grossen Rates vom 18.10.1928): in Fronarbeit errichtet von März 1923 an auf einem durch die Bemühungen des Arbeitersport-Kartells Basel vermittelten, auf einem vom Wasserwerk zur Verfügung gestellten ca. 20'000 Quadratmeter grossen Grasland-Areal. Die Längsseite der Anlage aus zwei Plätzen, auf dem auch die Feldhandballer ihre Spiele austrugen, schloss parallel zu den Bahngeleisen Basel-Leopoldshöhe an: „vom Grün der Wiesen eingerahmt mit Blick auf Oetlingen, in ganz staubfreier Lage liegt der zukünftige Jungbrunnen unserer Arbeiterturn- und Sportgenossen“ (Basler Vorwärts 30.5.1923). Für die Erstellung hatte sich eine Genossenschaft unter dem Titel 'Sportplatz-Union Basel' gebildet.
Eröffnungsspiel am 19. Juli 1924. Eröffnung Garderobe- und Wirtschaftsgebäude am 10. Mai 1925.
Satus
SC Kleinhüningen(78 x 46m - Pachtvertrag am 1.9.1923)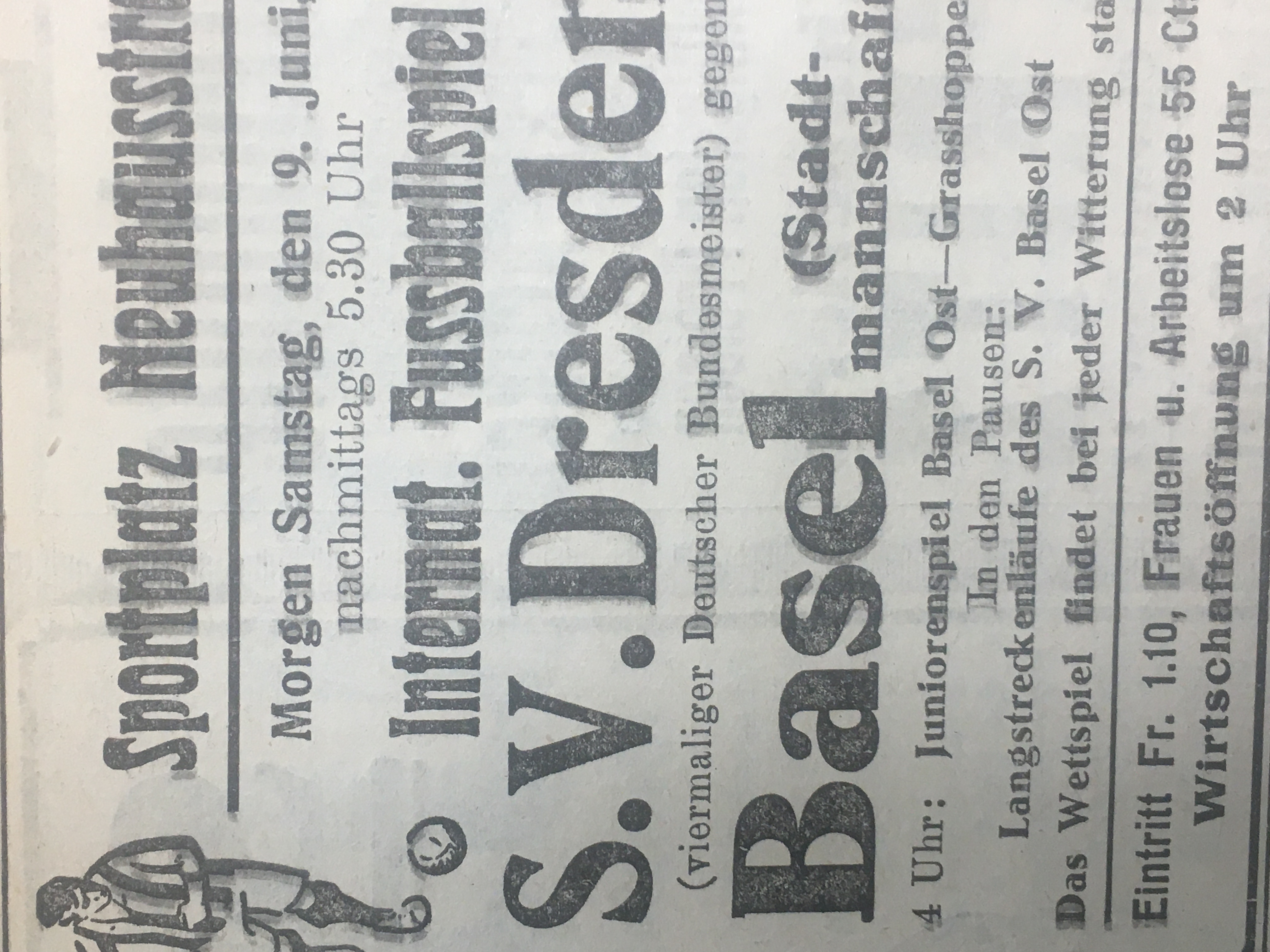
Sportplatz Clavelgut
1930 bis am 8. November 1936 an der Hiltalingerstrasse beim Gottesacker (Räumung für die Arbeiten am zweiten Hafenbecken): das 1928 vom Staat erworbene Clavelsche Gut war durch das Erziehungsdepartement zum grössten Teil für Sportzwecke an die Sportplatzunion der neu kommunistisch orientierten Arbeitersportvereine und an den SC Kleinhüningen abgegeben worden. Fertigstellung im Sommer 1931 „in über 8'000 freiwilligen Arbeitsstunden“ aus einem Obst- und Gemüseacker („bei dieser Gelegenheit machen wir nochmals auf unser Sportplatzrestaurant aufmerksam, dass allzu gefrörigen Besuchern warmen Aufenthalt bietet“ - Voranzeige Arbeiterfussballspiele Februar 1932)
Rotsport
SC Kleinhüningen (die Planierungs- und andere Platzarbeiten des neben dem Satus-Platz gelegenen Feldes wurden in Fronarbeit ausgeführt, was insgesamt 1'727 Stunden erforderte: für jede der nicht geleisteten 50 Pflichtstunden hatte ein Aktiver 50 Rappen zu entrichten)
FC Red Star (später St. Jakob als FC Schwarz-Weiss)
„Der Schiedsrichter war gut, bis auf einige Fehlentscheide, die Lörrach benachteiligten, aber an dem Resultat nichts geändert hätten, doch Lörrach, als gut disziplinierte rote Sportler fügten sich diesen Entscheiden und von diesen Sportlern hätten die bürgerlichen Clubs 'Pruntrut - Kleinhüningen', die nebenan spielten, etwas lernen können, nämlich Anstand gegenüber Gegner und Schiedsrichter“ (Spielbericht Vereinigte Sportfreunde - AFC Lörrach, Basler Vorwärts 7.2.1933): eine der ganz wenigen Erwähnungen darüber, dass auf der Anlage wie vorher bereits an der Neuhausstrasse auch der bürgerliche Sport ein- und ausging. Wie das Nebeneinander geregelt war, ist nicht überliefert, aber das Clavelgut bestand wie vorher schon der Sportplatz an der Neuhausstrasse aus zwei benachbarten Spielfeldern: auf der Postkarte, die vom Arbeitersportverband 1934 im Zusammenhang mit der Kündigung des Pachtvertrages durch die Basler Regierung herausgegeben wurde, lässt es sich nur erahnen.
Sportplatz Friedmatt
1920 bis Frühjahr 1930 an der Äusseren Mittleren Strasse (hinter dem Wasenboden - ausserhalb der Heil- und Pflegeanstalt Friedmatt), heute Flughafenstrasse (das als klein und uneben beschriebene Terrain musste wegen Pflanzlandzwecken abgegeben werden).
Die Fussballvereine FC Young Boys Basel, FC Black Stars und Verein für Rasenspiele, denen ihrer Terrains, die als Pflanzland zur Verwendung kamen, verlustig gegangen waren, verhandelten im Herbst 1920 zur Mietung je eines grossen Sportplatzes über den zum Spitalgut der 'Milchsuppe' gehörenden Landkomplex, welcher sich wegen seiner mageren Erdbeschaffenheit wenig zur Anpflanzung eignete und öfters zum Hornussen benutzt worden war.
Satus (ab 1927)
FC St. Johann
FC Young Boys (ab 1921 als SC St. Johann, vorher Vogesenstrasse)
SC Olympia (später Dreispitz - als BCO St. Jakob und Bachgraben)
VfR (ab 1925 im Wasenboden, nachher St. Jakob - als VfR Kleinhüningen Schorenmatte)
FC Sparta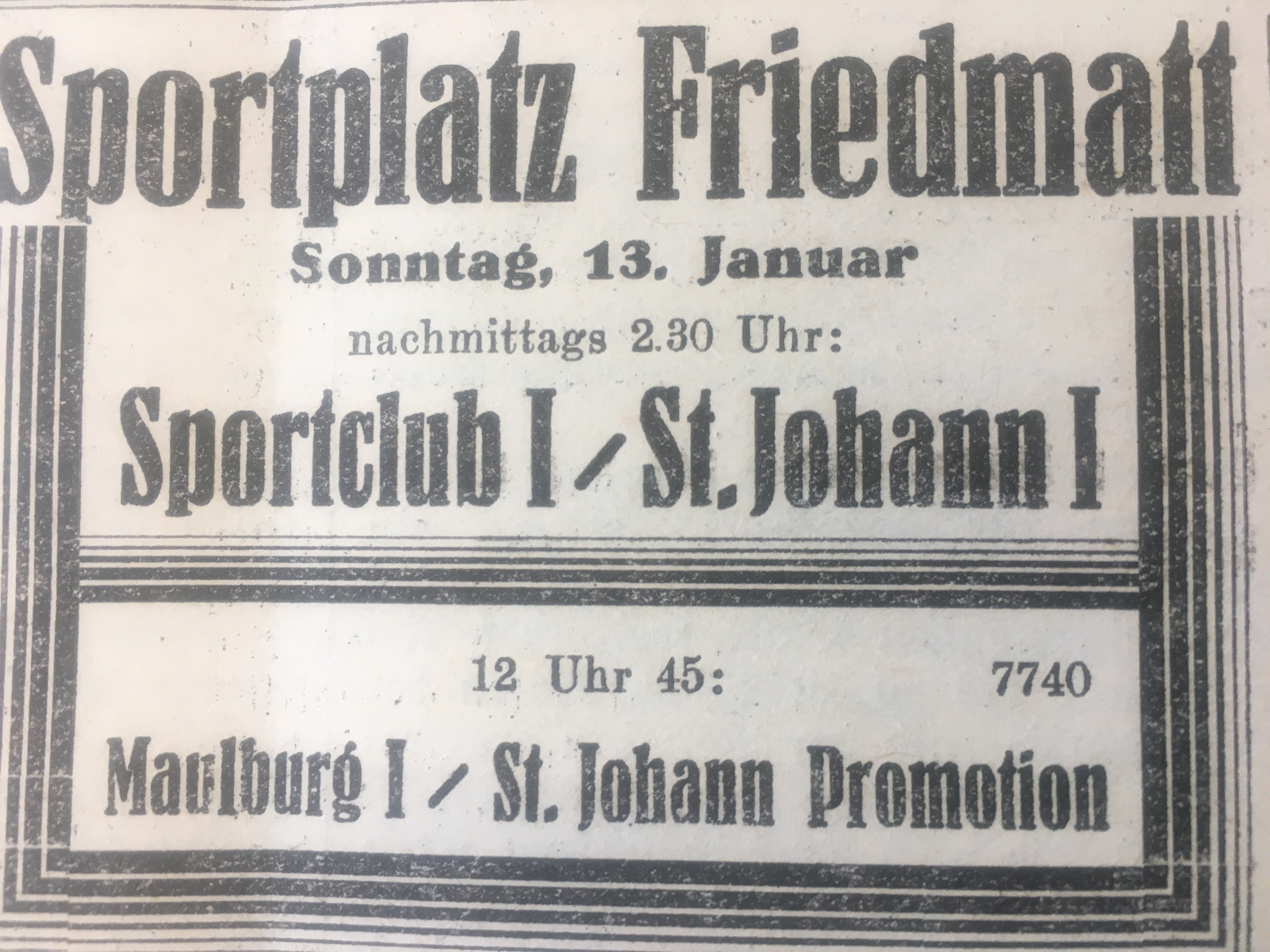
Sportplatz Friedmatt
31. Juli 1932 bis am 9. September 1995 (Bau Nordtangente: „gestern Montag wurde der Spielbetrieb auf dem Sportplatz Friedmatt endgültig eingestellt. Die beiden Fussballtore wurden zur Seite geschoben und die Eckfahnen entfernt“ - Basellandschaftliche Zeitung 12.9.1995) direkt an den vorherigen Platz anstossendes Terrain: das erste Meisterschaftsspiel fand am 2.10.1932 zwischen dem ASC Basel-West und dem SC Horburg statt.
„Es ist noch kein Vierteljahrhundert her, als auf dem grossen noch unbebauten Areal zwischen der jetzigen Flughafenstrasse und dem Trasse der Elsässerbahn drei Fussballfelder längs der französischen Grenze zur Benützung offen standen“ (Erinnerungen anlässlich des Jubiläumturniers des FC Sparta, NZ 3.7.1970)
Die Anlage, die an ihrer Nordseite an die elsässische Grenze stiess und westlich von einer viereinhalb Meter hohen Böschung begrenzt war, wurde 1957 saniert und darauf ein neues Garderobengebäude erstellt. Die Clubbeiz mit dem gedeckten Vorplatz vor drei Kastanienbäumen wurde später mehrfach umgebaut. Die letzte Sanierung (mit von der gleichzeitig umgebauten Grendelmatte geholten Rasenziegeln) der wegen ihres holprigen Zustandes bei den Gastmannschaften wenig beliebten Anlage („unsere Spieler waren beim Anblick des Spielfeldes nicht unbedingt begeistert, wies es doch mehr nackte, denn begraste Stellen auf“ - Spielbericht 5. Liga, FC Bubendorf-News 15.4.1980) fand 1984 statt, wofür nach der Auflösung der Sportplatzunion anfangs achtziger Jahre, die die beiden Sportplätze Friedmatt und Landauer wegen fehlender finanzieller Mittel nur ungenügend hatte betreuen können, der Verein Sportplatz Friedmatt, dem die Platzvereine ASC, Sparta und Olympia auch der ATV Basel-Stadt angehörten, verantwortlich zeichnete.
Der für die Vereine verlorene Sportplatz wurde durch die Sportanlage Paffenholz substituiert: 1996 entstand in Fronarbeit als Provisorium bis zur Neugestaltung des WWB-Areals in einer nicht mehr gebrauchten Werkstatthütte gleich entlang der Landesgrenze für ein paar Jahre auch ein neues Clubhaus
Rotsport, ab 1936 Satus
Satus (ab 1936)
SC ACV (vorher Satusgrund)
ASC (ASC Helvetik, ASC Sparta-Helvetik)
AFC Sparta (ASC Sparta-Helvetik)
AFC Ball-Boys (später Landauer)
SC Horburg (auch Landauer und Satusgrund)
SC Inter (Gastrecht)
US Juventina
US Olympia (aus US Palermo - später Pfaffenholz)
SC St. Johann (aus FC Young Boys St. Johann - anfangs bei der Arbeitshütte an der Vogesenstrasse 91)
FC Young Kickers (der Verein zügelte mit der Fusion mit Basel Nord 1982 auf den Satusgrund)
Sportplatz Äussere Grenzacherstrasse
Das im Herbst 1927 in Angriff genommene, durch die Güter Landauer und Bäumlihof bewirtschaftete Weideland ('hinter der Bierburg' beim Bettingerweg) genügte nach dem Verlust des Platzes an der Neuhausstrasse den Anforderungen des Arbeitersportes nicht, weshalb schon im darauffolgenden Jahr mit den Arbeiten am Clavelgut begonnen wurde.
„Seit längerem Unterbruch steht nun der Sportplatz Grenzacherstrasse für den Spielverkehr wieder offen. Er hat sich wesentlich verändert. Was früher eine steinige Spielfläche darstellte, ist jetzt mit einer Grasfläche überzogen: aber trotzdem ist beim Spielen etliches noch festzustellen, was noch immer die Ballbehandlung äusserst stark beeinflusst. Durch das Walzen des Spielfeldes mit Pferdegespann sind die tiefen Fussspuren der Pferde in der heutigen kalten Zeit eine stete Gefahr für den Spieler. Aber an und für sich ist das Spielfeld sehr anmutend und für spätere Zeiten, wenn es zur rechten Zeit mittels Handwalze nochmals gewalzt wird, eine gute Sportstätte“ (Spielbericht FC Grasshoppers Basel - ASC 1:1, Arbeiter-Zeitung 24.12.1929)
Während der Heu-Saison durfte kein Sport betrieben wird. Das Land wurde durch die Küngelzüchter gemäht und, nach Absprache mit den Vereinen, zum Fussballspielen freigegeben (Jubiläumschronik ASC).
Die Sportplätze Äussere Grenzacherstrasse (Autobus-Haltestelle 'Birsfelder Fähre') und Friedmatt wurden von der Sportplatz-Union Basel verwaltet. Einweihung neuer Aufenthaltsraum 9.10.1938: der zu klein gewordene Alte wurde zu Umkleideräumen umgestaltet.
Satus (13.11.1927-1929, ab 1936)
Rotsport (1930-1936)
Sportplatz Landauer
Die 1945 umbenannte Anlage 'hinter den Pflanzgärten', welche während des Krieges angepflanzt war, wurde im Frühjahr 1949 überholt und als Folge der grossen Beanspruchung letztmals 2012 saniert. Der Landauer gehörte mit dem Satusgrund zu den meistbelasteten Fussballplätzen der Region („an ein Trainieren auf dem Hauptplatz ist schon gar nicht zu denken. Wir müssen uns mit einem Rasenstreifen hinter dem Tor oder neben dem Handball-Hartplatz begnügen“ - 1989) und wurde bei Regen als sumpfig und glitschig beschrieben. Er ist wie die (ehemaligen) autonomen Sportplätze Rankhof, Satusgrund und Hörnli im Gebiet zwischen dem Bahndamm der Deutschen Bahn und der Grenzacherstrasse gelegen und verbleibt mit letzterem als private Genossenschaft.
FC Alkar (später Pfaffenholz)
ASC Sparta-Helvetik (vorher Pfaffenholz)
„Auf den St. Jakob- oder Pfaffenholz-Anlagen funktioniere zwar alles perfekt, aber man sei dort nur eine von zehn Mannschaften (...) In der Tat wähnt man sich auf dem Landauer in einer dörflichen Parallelwelt mitten in der Stadt. Das gemütliche Clubhaus gleicht einer Dorfspelunke, und irgendwie schauen die Gäste so aus, als ob sie jeden Abend hier einkehren würden“ (Basellandschaftliche Zeitung 13.9.2008)
„Es gibt nur noch wenige Plätze, die eine eigene Beiz haben, unserer ist einer davon. Das hier hat kaum mehr jemand. Diese Oase muss man am Leben erhalten, sie ist sensationell. Das schätzen auch die gegnerischen Mannschaften, wenn sie zu uns kommen“ (Lukas Neubauer, bz Basel 25.11.2022)
AFC Ball-Boys (vorher Friedmatt - FC Fortuna/Ballboys)
FC Basel West (nachher als FC Nord West auf dem Sportplatz Kittler in Frenkendorf)
FC Fortuna (FC Fortuna/Ballboys - 3. Liga-Team St. Jakob. 1931-1936 Satusgrund)
FC Grasshoppers (Nachfolgeverein FK Vardar)
SC Horburg (vorher Neuhausstrasse und Clavelgut; später auch Friedmatt und Satusgrund - Vereinigte Sportfreunde/Horburg)
FC Sportfreunde (vorher Bachgraben und St. Jakob)
Vereinigte Sportfreunde (Vereinigte Sportfreunde/Horburg)
AS Timau (später St. Jakob, Bäumlihof, Bachgraben, Pfaffenholz und Rankhof)
FC UBS (seit 2013, später Rheinacker - Firmensport)
FK Vardar
Sportanlage Satusgrund (Sportplatz am Rhein/ Sportplatz Grenzacherstrasse) Spielfeld 100 x 70 m
12.10.1930 bis am 9. April 1995 Ecke Grenzacherstrasse-Allmendweg: durch freiwilligen Arbeitsdienst der ursprünglichen Platzvereine ASV Basel-Ost und ASTV Basel Neue Sektion entstanden (Pachtvertrag mit dem Gas- und Wasserwerk).
Einweihung des grossen Spielfeldes mit 400-m-Aschenbahn am 27. September 1931 mit einem Fussball-, Handball- und Tauziehenturnier. Der Eingang befand sich an der Grenzacherstrasse 419, wo links davon eine Ankleide- und Wirtshaushütte sowie Abort- und Douchenanlagen erstellt wurden. Die Gesamtkosten von 50'000 Franken wurden durch Aufnahme von Darlehen, Ausgabe von Anteilsscheinen (Genossenschaft), staatliche Subventionen und das Erträgnis einer Tombola aufgebracht:
„Sämtliche Spiele der Serie B 1935/36 finden auf dem kleinen Spielfeld des Satusgrund statt, wofür die Sportplatzgenossenschaft nun in zuvorkommender Weise Tornetze angeschafft hat“ (AZ 28.10.1935)
Das ab 1939 beleuchtete Trainingsfeld war während des Krieges angepflanzt und wurde auf September 1945 seinem ursprünglichen Zweck wieder zugeführt.
Mit dem Spiel der Landesliga Vereinigte Sportfreunde gegen Carouge Genève wurde am 16.10.1949 das vollständig überholte grosse Spielfeld wieder dem Betrieb übergeben. Die Platzanlagen umfassten neben den beiden Spielfeldern und der 400-m-Aschenbahn ein Aufenthalts- und Garderobengebäude, zwei Geräteschöpfe, zwei kleinere Umkleidehütten, das Abwartswohnhaus sowie vier Tennisfelder.
Gesamterneuerung von Aschenbahn, Sprunganlagen, A-Feld und Einfriedung längs der Grenzacherstrasse Inbetriebnahme 1.5.1956 (durch den Verein zur Unterhaltung von Arbeitersportplätzen, der 1947 in Anpassung an das neue Obligationenrecht aus der Satusgrund-Genossenschaft hervorging).
1958 wurde das nur 80 auf 60 Meter umfassende B-Feld verlegt und auf den vorgeschriebenen Masstab vergrössert. Ende der 80er Jahre wurde der sanierungsbedürftige Satusgrund mit seiner 'dürftigen Leichtathletikanlage', den sich neben dem Schulsport knapp 20 Teams teilen mussten, zum Unterhalt an den Staat abgetreten. Das Nebenfeld, auf dem die Trainings bei jedem Wetter durchgeführt wurden, war wegen seines schlechten Zustandes ab 1983 für Wettspiele gesperrt. Abhilfe fand sich in einem Allwetterbelag.
Platzrekord: 1.5.1947 Schweiz vs. Frankreich Arbeiter-Auswahlspiel ca. 3'500
Satus
SC ACV Satus (später Friedmatt)
FC Austria
Neue Sektion/ SC Basel Nord (später Hörnli - SC Basel Nord/Young Kickers)
ASV Basel-Ost
SC Baudepartement
„In der Zwischensaison im Februar war der Platz drei Wochen nicht bespielbar. Jetzt haben wir den holprigen Nebenplatz mit den anderen Satus-Vereinen Basel-Nord, Basel-Ost, BVB, Rapid, der Neuen Sektion und zeitweise auch mit der Satus-Skisektion zu teilen“ - BaZ 23.4.1981
Das Fanionteam bestritt nach einer Übergangs-Ausnahmebewilligung am 26.4.1987 erstmals ein Heimspiel im Leichtathletikstadion St. Jakob, weil der Satusgrund für 1. Liga-Spiele 2,60 m zu kurz war. Weil der Platz an Wochenende hoffnungslos überfüllt war, blieb man - obwohl auf dem Satusgrund durch die Nähe zum Spielgeschehen eine bessere Atmospähre herrschte - auch wegen der fehlenden Parkmöglichkeiten danach zunächst in der Brüglinger Ebene, bis man später auf den neuen Rankhof zurückkehrte)
SC Strassenbahn/ SC BVB
SC Geba (AFC Erlen)
SC Horburg (auch Friedmatt und Landauer)
ASS Irpinia
Neue Sektion Spalen
Neue Sektion Wagons-lits
SV Rapid (AS Rapid-Randazzo)
FC Young Kickers (auch Friedmatt)
SPORTANLAGEN, FUSSBALLPLÄTZE FIRMEN (Nordwestschweiz)
Sportplatz Geigy/ Sportanlagen Landauer (Landauerstrasse 45)
8. August 1936 bis 1. März 2013 nach zwei Jahren Planierungsarbeit und der Abtragung von 2'000 Kubikmetern erstellt von den Angestellten der Firma auf einem sich im Privatbesitz von Dr. Rudolf Geigy befindlichen Areal an der Grenzacherstrasse („im hübschen Clubhäuschen sind die Umkleide- und Baderäume mit Kalt- und Warmwasser mustergültig eingerichtet. Ein Materialzimmer vervollständigt die Räumlichkeiten“).
Renovation 1948. Neues Clubhaus 1971.
2013 wurden die Aktivitäten auf die Novartis-Sportanlage in Hüningen verlagert. Der Platz wird seither vom Sportamt gepachtet und kann unter seinem neuen Namen Rheinacker von den Mannschaften des Fussballverbandes genutzt werden. Definitive Übernahme durch den Kanton per 1.1.2025.
- SC Geigy, bzw. ab dem 1. Januar 1973 SC Ciba-Geigy Rosental (als autonome Sektion des Sportverbandes Ciba-Geigy zwei Jahre nach der Fusion der beiden Chemiefirmen), bzw. ab 1992 SC Ciba Rosental, bzw. ab ab 1997 als SC Novartis Rosental (Fusion mit Sandoz). Seit 26.3.2009/ 31.5.2010 (Fussball) als SC Novartis (Fusion SC Novartis St. Johann, SC Novartis Rosental und Schachclub Novartis)
Sportanlagen Ciba/ Sportanlage Ciba Spezialitätenchemie (Baselmattweg 135, Neu-Allschwil BL)
21. April 1979 Einweihung neue Gesamtanlage für Fussball, Tennis und Boccia mit Clubhaus und Restaurant auf einem Gelände von 25'500 Quadratmetern. Durch die Umzonung der Parzelle, welche 2011 von einem privaten Investor erworben worden war, entstand 2013 einer Wohnüberbauung.
Als dritte Firma auf dem Platz Basel nach dem Bankverein und Geigy hatte Ciba 1947 für seine Sporttreibenden ein Areal erworben und 26 kleine Parzellen am Bachgraben gekauft. Eine Vergrösserung des Sportplatzes Ciba am Bachgraben (Tram 6, Haltestelle Kirche), die zwischen 1950 und 1952 erstellt worden war und zwischenzeitlich auch dem FC Allschwil diente, erfolgte 1956.
- SC Ciba, bzw. ab 1. Januar 1973 SC Ciba-Geigy Klybeck (als autonome Sektion des Sportverbandes Ciba-Geigy zwei Jahre nach der Fusion der beiden Chemiefirmen), bzw. ab 1992 SC Ciba Klybeck, bzw. ab 1997 SC Novartis Klybeck (Fusion mit Sandoz). Ab 1998 als SC Ciba Spezialitätenchemie (Ausgliederung Ciba Spezialitätenchemie)
Sportanlagen Sandoz/ Sportanlagen Novartis St. Johann (Hüningen, Frankreich)
11. Mai 1968 u.a. auch für Faustball, Hartplätzen für Volleyball, Handball und Korbball sowie Bocciabahnen, einer Tischtennishalle und zehn Tennisplätzen inkl. eines Restaurants mit einer Fläche von 43'500 Quadratmetern ('ein piekfein hergerichtetes Sportgelände in nächster nähe des Arbeitsplatzes ennet der Lysbüchel-Landesgrenze'). Zum 40jährigen Jubiläum des Clubs, das mit dem 75jährigen Jubiläum der Firma zusammenfiel, hatte die Geschäftsleitung grünes Licht für den Bau eines Sportplatzes auf dem ehemaligen Gelände des Golf- und Countryclubs Basel jenseits der Grenze gegeben, der ein für Nachtspiele beleuchtetes Haupt- von 112 auf 74 Meter sowie ein Trainingsfeld von 90 auf 60 Meter aufwies - „mit dem Vorteil, diese unmittelbar neben dem Betrieb erstellen zu können, während andere Firmen weit aufs Land ziehen mussten oder aus finanziellen Gründen gar nicht in der Lage waren, betriebseigene Anlagen anzubieten“
Neues Clubhaus am 5. Mai 1988, nachdem das alte am 24. August 1985 einem Brand zum Opfer gefallen war.
- SC Sandoz, bzw. ab 1997 SC Novartis St. Johann (Fusion mit Ciba-Geigy). Seit März 2009 als SC Novartis (Fusion SC Novartis St. Johann, SC Novartis Rosental und Schachclub Novartis)
Sportanlagen Roche (Friedhofstrasse 30, Birsfelden BL)
3.11.1962 gleich neben der sich bereits im Bau befindlichen Gemeindesportanlage Sternenfeld auf einer Fläche von 1'200 Quadratmetern mit einem Fussballplatz, Hartplatz und verschiedenen zusätzlichen Feldern für Ballspiele. Eine gedeckte Boccia-Bahn schliesst den Rasen gegen die mächtige, zur damaligen Zeit 'für die Schweiz einzigartige' Mehrzweckhalle mit Kantine ab, in deren UG neben den Garderoben, einem Sitzungszimmer und dem Raum für den Schiedsrichter der Schiesskeller und Ecken für Tischtennis zu liegen kamen. Neue Flutlichtanlage 1971.
- SC Roche
Sportanlagen Schweizerische Bankgesellschaft SBG/ Sportanlage UBS (Hegenheimermattweg 104, Allschwil BL)
Zwischenzeitlich war auch erwogen worden, ins benachbarte Elsass nach Hegenheim auszuweichen, aber man gelangte zur Auffassung, dass ein Sport- und Freizeitcenter auch mit dem öffentlichen Verkehrsmittel schnell erreichbar sein müsse. Nachdem die Gemeinde Allschwil den Grüngürtel am Bachgraben zweckbestimmend unter anderem zur Erstellung von Sportplätzen ausgesondert hatte, konnte dort 'zu einem akzeptablen Preis' Land gekauft werden.
Eröffnung zweite Hälfte Oktober 1978 als polysportive Anlage mit einem Clubhaus und u.a. vier Tennisplätzen, Bocciabahn und Tischtennisplätzen. Der Fussballplatz hatte eine Grösse von ca. 80 x 45m.
Als 2011 die Sportanlage der Ciba am Baselmattweg an einen privaten Investor für die Realisierung einer Wohnüberbauung verkauft wurde, konnte die Anlage nach dem Erwerb durch die Einwohnergemeinde ab 2013 mit neuen Tennisplätzen, Boccia-Halle und Pétangue-Bahnen umgestaltet und als zusätzliche Möglichkeit für den FC Allschwil bei der Sportanlage im Brüel als Realersatz für seinen weggefallenen Sportplatz Gartenhof das Spielfeld vergrössert werden.
- SC Bankgesellschaft
Am Allschwiler Hegenheimermattweg 80 - allerdings ohne Fussballfeld - fand mit der Eröffnung am 22. November 1987 auch die Schweizerische Kreditanstalt/ Credit Suisse einen Platz für ihre Sportler mit Clubhaus, Kegelbahn, Tischtennishalle, Tennisplätzen sowie einer Spiel- und Liegewiese. Die Kreditanstalt spielte aber auf den Sportanlagen St. Jakob und später Bachgraben Fussball. Die Anlage wurde 2001 verkauft und zum TC Hagmatt.
Sportplatz Bankverein (Langenlohnweg, Parkallee-Sandweg Neu-Allschwil BL)
5. Oktober 1924 (Eröffnung SC Bankverein - FC Basel Senioren 3:3) mit drei Tennisplätzen.
Platzrekord: 3.12.1944 FC Allschwil - FC Basel 2'500 Schweizer Cup 1/32 Final
Sportanlagen Bankverein/ Sportanlagen UBS 29.9.1951 bis 2004 (der bis Mitte 1999 von der UBS benutzte Sportplatz wurde danach von der Bauherrschaft noch dem FC Allschwil zur Verfügung gestellt) auf einem 20'500 Quadratmeter, durch Ankauf eines Landstückes erweiterten Areals mit 100-m-Aschenbahn, Sprunganlage, vier Tennisplätzen, Tischtennis, zwei Bocciabahnen und Clubhaus: der verlegte Fussballplatz von 95 Metern Länge und 65 Metern Breite, an den sich gegen die Stadt ein leicht erhöhtes Feld für Korbball anschloss, kam neu zwischen der Parkallee (parallel) und dem Sandweg zu liegen und wurde mit einem Freundschaftstreffen gegen die Associative Sportive de Bourse de Paris eingeweiht.
Aufgabe nach der Fusion des Bankvereins mit der Schweizerischen Bankgesellschaft zur UBS, weil diese im linksufrigen Bachgrabengebiet ebenfalls über eine Sportanlage verfügte, zugunsten einer grossen Wohnüberbauung.
- SC Bankverein/ SC UBS, bzw. ab 2004 FC UBS (ab 2000 Sportanlage Ciba Baselmattweg, später Sportplätze Gartenhof und im Brüel)
Sportanlagen BIZ (Kreuzackerweg, Bottmingen BL)
Seit 1963
- SC BIZ
PTT-Anlage/ Post Sportanlage (Arlesheim BL)
1987 bis am 31. Dezember 2022. Die Anlage gehörte der Schweizerischen Post und wurde durch die Interessengemeinschaft Post betrieben.
- FC Post (vorher St. Jakob)
- SC Zoll (vorher St. Jakob)
Sportplatz Ronda (Lausen BL): auf dem Rasenplatz neben der Firma fand ab 1977 ein (seit 1962 und vorher auf der Sissacherfluh ausgetragenes) jährliches Turnier für die Betriebsangehörigen statt.
- FC Ronda (keine Verbandszugehörigkeit)
Sportanlage Dürrenhübel Säurefabrik Schweizerhall/ SF-Chem (Pratteln BL)
12. Mai 1979 bis 23.6.2007 auf den von der Saline Schweizerhall gepachteten Landflächen im Bereich der Bohrtürme.
Wurde dem Erschliessungsplan Salina-Raurica geopfert.
- FC Säurefabrik, bzw. FC Säurefabrik + Promena (Zusammenschluss 1992). Ab 2001 bis 2007 als FC SF-Chem
- SC Promena
- SC Ciba Schweizerhalle
Sportplatz Bata-Park (Möhlin AG)
Ab ca. 1933.
- FC Bata Möhlin
Sportplatz Bustelbach Ciba-Geigy (Stein AG)
27.11.1970
- SC Ciba-Geigy Fricktal, ab 16.3.1973 SC Ciba-Geigy Werk Stein
Sportanlage Bustelbach Ciba-Geigy/ Novartis
1982 Vollendung Sportanlage mit Hartplatz, zwei Tennisplätzen, einem Clubhaus und für Tischtennis: Fussball wurde nebenan auf dem Sportplatz Bustelbach gespielt (FC Stein). „Die verstärkte Einführung der Schichtarbeit erschwerte es, den Gruppensport mit festen Trainingstagen und -zeiten zu organisieren“ (Festschrift 100 Jahre Firmensport Novartis)
- SC Ciba-Geigy Werk Stein, bzw. ab 1996 SC Novartis Stein. Am 1.1.2010 wurde ein neuer FC Novartis Stein lanciert, der ab der Saison 2013/14 (bis 2016) wieder an der Meisterschaft teilnahm
Sportplatz Roche/ DSM (Sisseln AG)
28.5.1972 zwischen dem Werk der Hoffmann-La Roche AG und dem ehemaligen Restaurant Fricktalerhof, dem Roche-Personalhaus. 115 x 65m.
- SC Roche Sisseln
| nach oben |